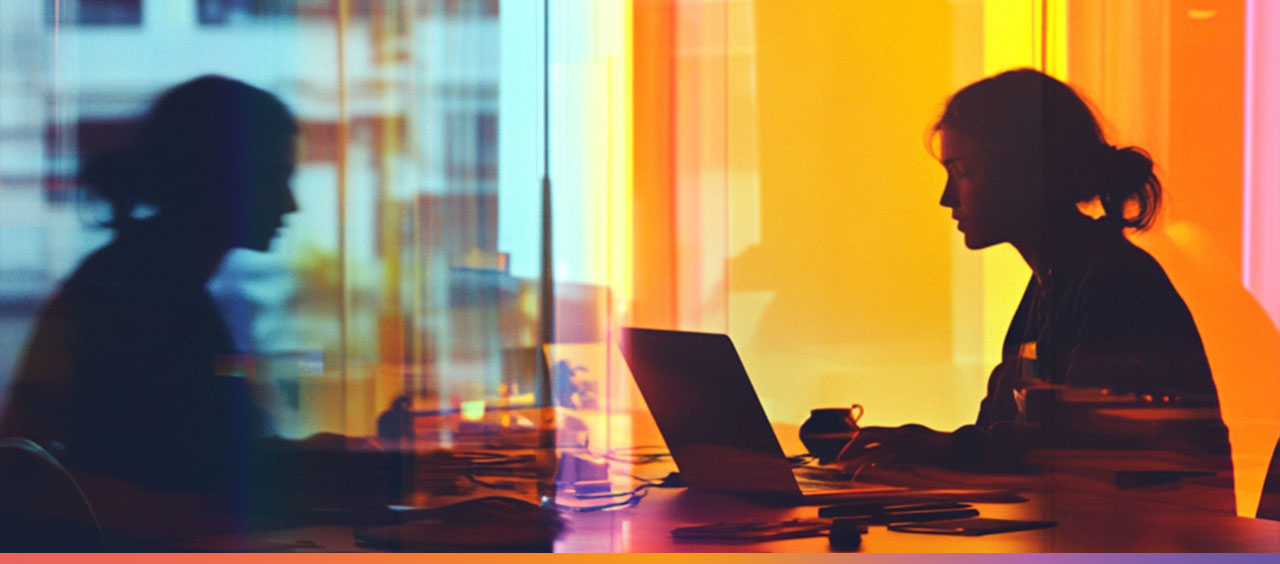Anm. zu BGH: BGH vs. BAG - Kündigung eines Geschäftsführeranstellungsvertrages
Arbeitsrecht
Der BGH hat mit seinem Urteil vom 5.11.2024 (II ZR 35/23) entschieden, dass bei außerordentlicher Kündigung des Anstellungsvertrages eines Geschäftsführers einer GmbH aufgrund vertraglich vereinbarter wichtiger Gründe die Erklärungsfrist des § 626 Abs. 2 BGB gilt. Darüber hinaus hat der BGH im Rahmen eines obiter dictum an seiner Rechtsprechung festgehalten, auf Geschäftsführer, die keine Mehrheitsgesellschafter sind, die zum Nachteil des Geschäftsführers grundsätzlich nicht abdingbaren (§ 622 Abs. 4, 5 BGB) Kündigungsfristen für Arbeitsverhältnisse (§ 622 Abs. 1, 2 BGB) entsprechend anzuwenden. Insoweit widerspricht der BGH der BAG-Rechtsprechung laut Urteil vom 11.6.2020, 2 AZR 374/19 (Entscheidungszusammenfassung mit Praxishinweisen der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB).
Sachverhalt:
Die Beklagte ist ein in Form der sog. Einheits-GmbH & Co. KG organisiertes Biotechnologieunternehmen, d.h. die Gesellschaftsanteile der kapitalanteillosen Komplementärin hält zu 100% die Beklagte.
Der Kläger war seit 2001 aufgrund eines mit der Beklagten abgeschlossenen Geschäftsführeranstellungsvertrages (GAV) als einer von mehreren Geschäftsführern der Komplementär-GmbH tätig, wobei dieser auch die Geschäfte der Beklagten führte.
In § 4 Abs. 1 GAV wurde eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten für die ordentliche Kündigung vereinbart. § 4 Abs. 2 GAV regelte ohne weitere Fristenregelungen die Kündigung aus wichtigem Grund. Dabei war als wichtiger Grund u.a. die Liquidation der Gesellschaft vereinbart.
Die Gesellschaftsversammlung beschloss am 8.3.2016 in Anwesenheit des Klägers die Auflösung der Gesellschaft sowie hinsichtlich des GAV die sofortige außerordentliche, hilfsweise ordentliche Kündigung zum nächstmöglichen Datum bzw. Beendigung mittels Aufhebungsvereinbarung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wurde bevollmächtigt die erforderlichen Erklärungen abzugeben. Mit Schreiben vom 22.3.2016, dem Kläger am 23.3.2016 zugegangen, kündigte der Aufsichtsratsvorsitzende den GAV im Namen der Beklagten außerordentlich zum 30.4.2016, hilfsweise ordentlich zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Mit Schreiben vom 7.6.2016 wurde die Kündigung erneut “hilfsweise und vorsorglich” erklärt und zwar außerordentlich sowie hilfsweise ordentlich zum nächstmöglichen Termin.
Der Kläger begehrte vor dem LAG die Feststellung, dass sein Geschäftsführeranstellungsverhältnis mit der Beklagten durch die ausgesprochene Kündigung nicht aufgelöst worden ist sowie die Zahlung der Vergütung nebst Zinsen bis Januar 2017 nebst Rechtsanwaltskosten (Klageantrag zu 4). Das LAG hat den Klageantrag 1 und 2 stattgegeben, im Übrigen diese abgewiesen. In der Berufung begehrte der Kläger hinsichtlich Klageantrag zu 3 nur noch die Monatsvergütung für die Monate Mai und Juni 2016. Auf die Berufung wurde die Klage abgewiesen.
Entscheidungsgründe:
Der BGH hat dem Kläger einen Anspruch auf die Monatsvergütung für die Monate Mai und Juni 2016 zugesprochen. Der Anspruch ergebe sich aus § 615 Satz 1 BGB in Verbindung mit dem Geschäftsführungsanstellungsvertrag. Weder die Kündigung vom 22.3.2016 noch jene vom 7.6.2016 habe den Anstellungsvertrag zum 30.6.2016 beendet.
Die außerordentliche Kündigung vom 22.3.2016 habe den Vertrag nicht beendet, da § 626 Abs. 2 BGB nicht eingehalten worden sei. Dieser gelte nach BGH auch bei außerordentlicher Kündigung des Anstellungsvertrages eines Geschäftsführers einer GmbH wegen vereinbarten wichtigen Gründen. Dem stehe nicht entgegen, dass nach der Rechtsprechung des BGH, nach der die Mindestkündigungsfristen des § 622 BGB analog gelten, der Gekündigte doppelt geschützt würde. Für die Anwendung des § 626 Abs. 2 BGB spräche gerade, dass der Gekündigte auch bei vertraglich vereinbarten wichtigen Gründen ein Interesse daran habe, zügig Klarheit darüber zu erlangen, ob eine Kündigung erfolgt. Dieses Interesse müsse nicht deswegen zurückstehen, weil er über § 622 Abs. 1, 2 BGB analog geschützt werde, jedenfalls nicht, wenn wie hier die anstellungsvertragliche Fristenregelung für die ordentliche Kündigung § 622 BGB übersteige. Unerheblich sei, dass die Parteien die Geltung des § 626 Abs. 2 BGB in § 4 Abs. 2 GAV nicht vereinbart haben, da dort lediglich einige wichtige Gründe für die Kündigung vereinbart worden seien, ohne weitere Modalitäten zu regeln. Für die Einhaltung der Zweiwochenfrist nach § 626 Abs. 2 BGB kam es auf den Wissensstand der Gesellschafterversammlung an, somit am 8.3.2016, sodass die Frist am 22.3.2016 abgelaufen und die Kündigung verspätet gewesen sei. Für den Zugang der Kündigungserklärung könne nicht auf die Gesellschafterversammlung am 8.3.2016 abgestellt werden, da die Beschlussfassung und der Umsetzungsakt nicht in einen Akt zusammenfielen, denn ein solcher Wille konnte angesichts der Bevollmächtigung des Aufsichtsratsvorsitzenden zur Kündigungserklärung nicht festgestellt werden. Angesichts der Verfristung der Kündigung sei es auf die Bestimmung, welche Kündigungsfristen auf Dienstverhältnisse von Geschäftsführern, die keine Mehrheitsgesellschafter sind, anzuwenden sind, nicht mehr angekommen. Der BGH halte weiter an seiner Rechtsprechung fest, dass auf den Geschäftsführer die grundsätzlich nicht abdingbaren (§ 622 Abs. 4, 5 BGB) Kündigungsfristen für Arbeitsverhältnisse (§ 622 Abs. 1, 2 BGB) entsprechend anzuwenden seien und zwar auch dann, wenn wie hier der Geschäftsführer der GmbH seinen Anstellungsvertrag mit der beklagten Kommanditgesellschaft abgeschlossen habe. Der Gesetzgeber habe anlässlich der Reform des Kündigungsfristengesetzes im Jahr 1993 (RegE, BT-Drucks. 12/4902) in offenbarer Kenntnis der Rechtsprechung des BGH die Frage der Kündigungsfristen für Organmitglieder weder angesprochen noch korrigiert und damit die Rechtsprechung gebilligt. Diese Gesetzesänderung sei mit der Zielsetzung erfolgt, die Fristen bei der ordentlichen Kündigung für Arbeiter und Angestellte sowie die Rechtslage in den neuen und alten Bundesländern zu vereinheitlichen. Eine bewusste Wertentscheidung § 622 BGB nur auf Arbeitsverhältnisse zu beschränken sei nicht erkennbar.
Hinweis für die Praxis:
Der BGH weicht bewusst von der Rechtsprechung des BAG (Urteil v. 11.6.2020,2 AZR 374/19) ab. Dieses hielt § 622 Abs. 2 BGB auf den Geschäftsführer, der nicht Mehrheitsgesellschafter der GmbH ist und zu ihr in keinem Arbeitsverhältnis steht, für nicht anwendbar, da dieser ausweislich seines Wortlautes nur für Arbeitsverhältnisse gelte. Im Übrigen war das BAG der Auffassung, dass es wegen der Regelung des § 621 BGB an einer planwidrigen Regelungslücke für freie Dienstverhältnisse fehle. Das BAG war noch der Auffassung, dass die Neufassung des § 622 BGB aus dem Jahr 1993 die Anbindung der Kündigungsfristenregelung an das Arbeitsverhältnis betone. Nach dem BAG habe der Gesetzgeber gerade davon abgesehen, die Rechtsprechung des BGH in eine gesetzliche Regelung zu übernehmen, obwohl die Neuregelung der Kündigungsfristen dazu Anlass gegeben hätte. Die Entscheidung des BGH ist insofern doppelt spannend. Zum einen ist bei der außerordentlichen Kündigung von Geschäftsführern aufgrund vereinbarter wichtiger Gründe Eile geboten, da auch hier § 626 Abs. 2 BGB greift. Zum anderen widerspricht der BGH deutlich der Rechtsprechung des BAG (a.a.O.) hinsichtlich der entsprechenden Anwendung des § 622 Abs. 1 und 2 BGB auf Geschäftsführeranstellungsverträge und betont die Fortgeltung seiner Rechtsprechung (Urteil vom 29.1.1981,II ZR 92/80) auch nach der Reform des Kündigungsfristengesetzes. In der Beratung und der Vertragsgestaltung ist dies zu berücksichtigen.
Autor: Dr. Andreas Schubert, Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht, Friedrich Graf von Westphalen und Partner mbB, Freiburg i.Br.
Quelle: BGH, Urteil vom 5.11.2024 (II ZR 35/23)