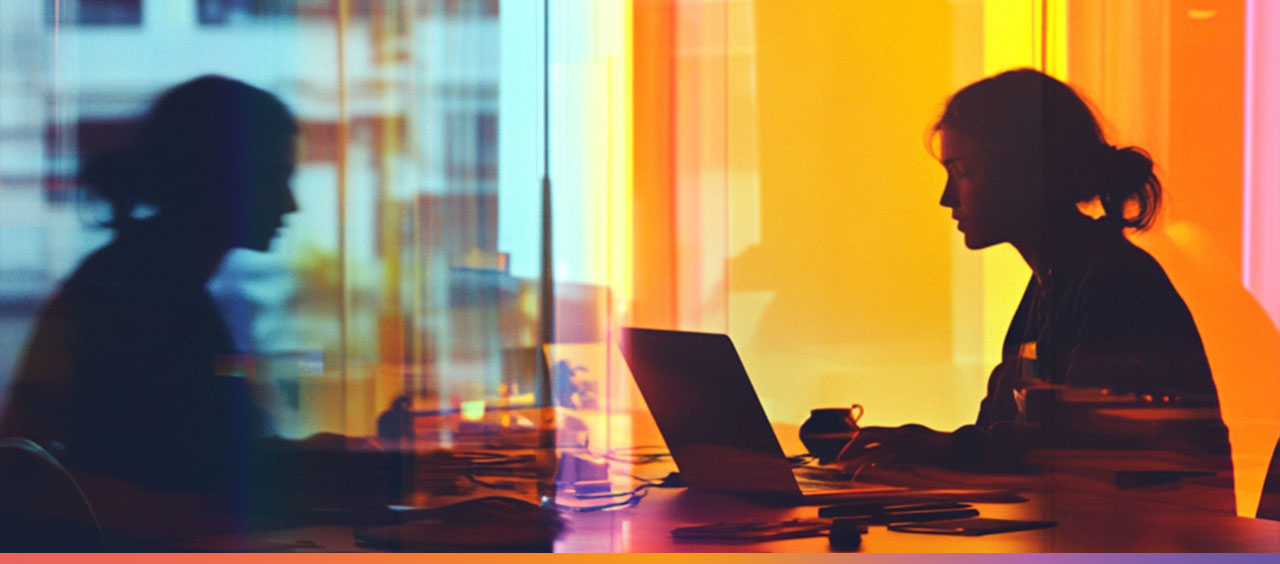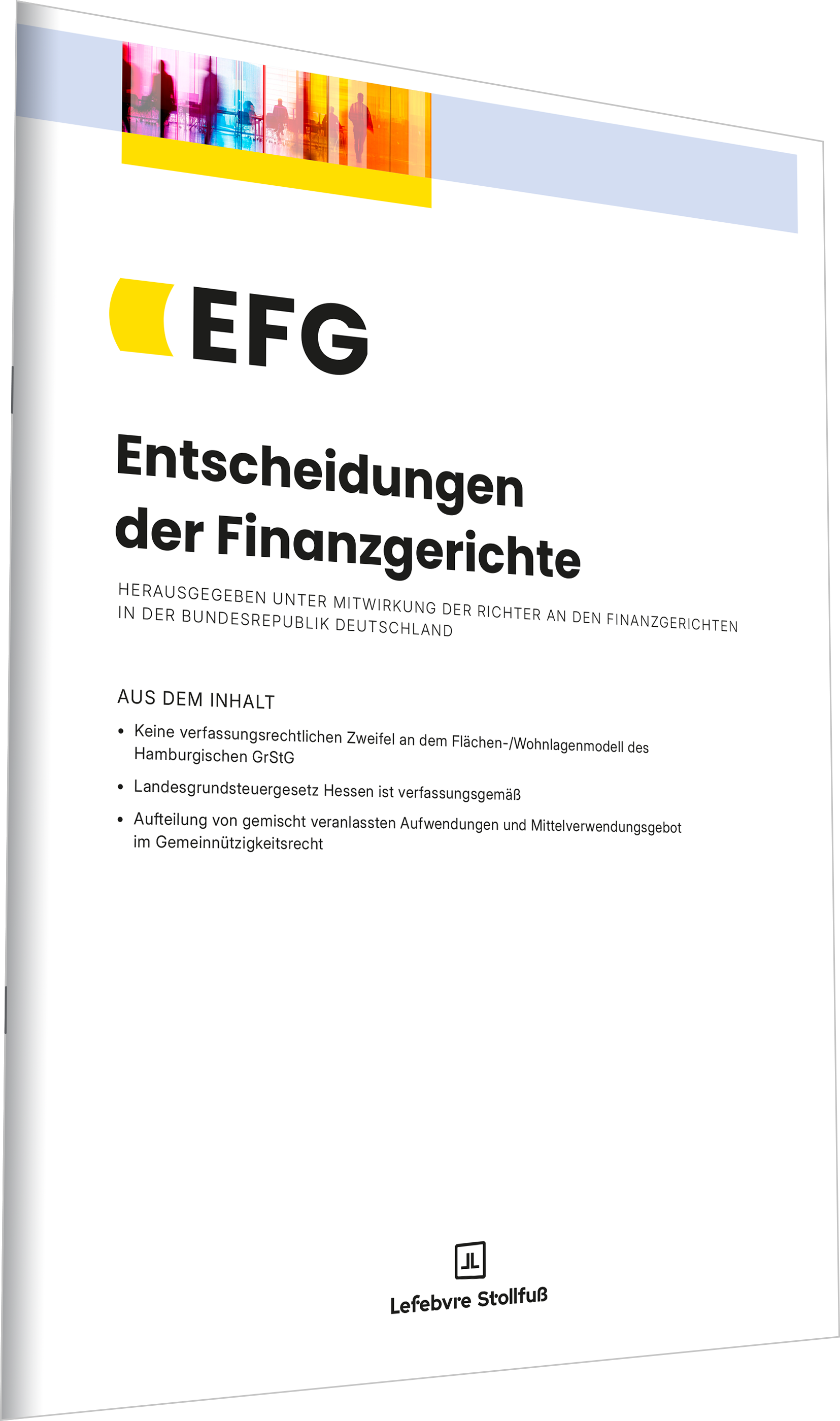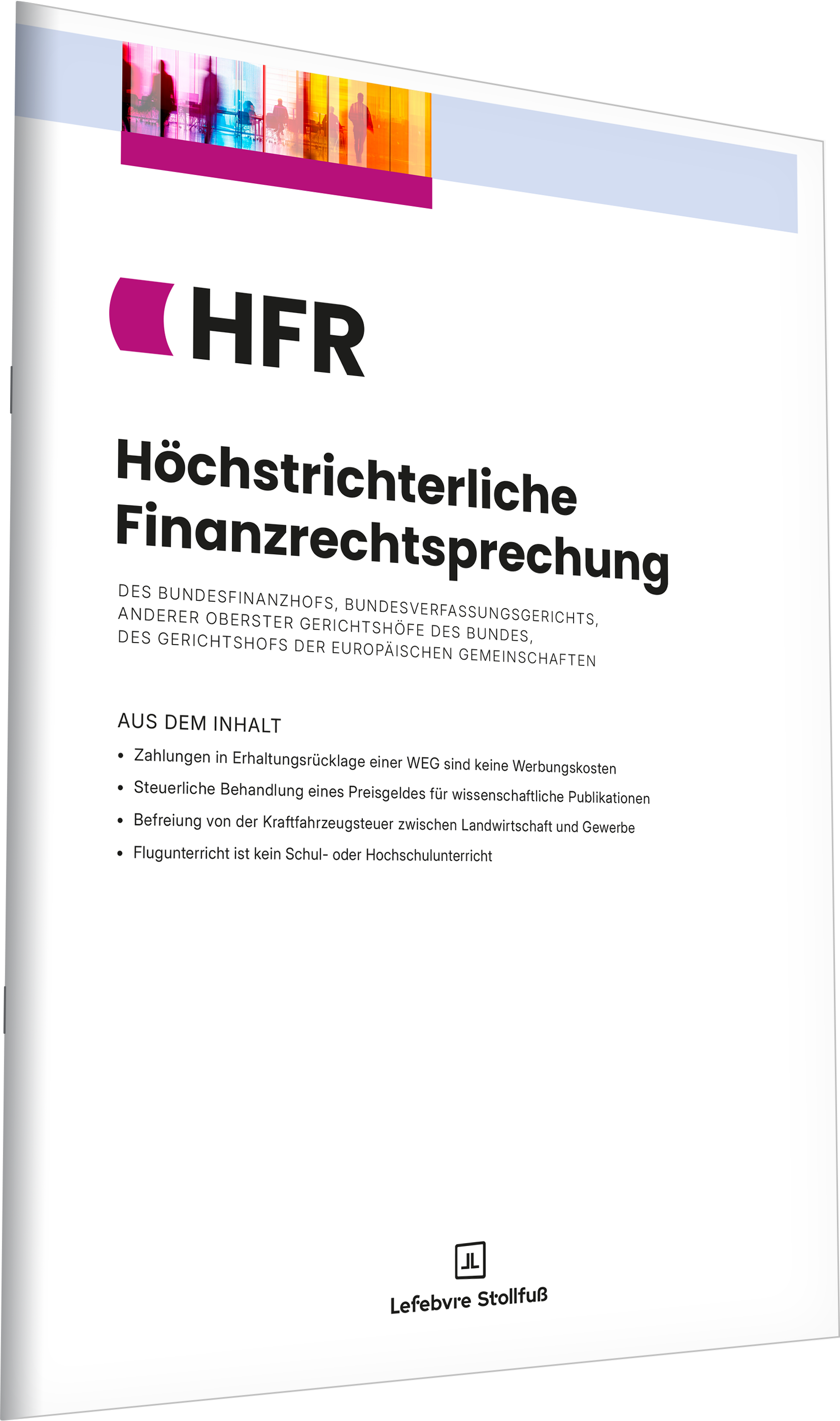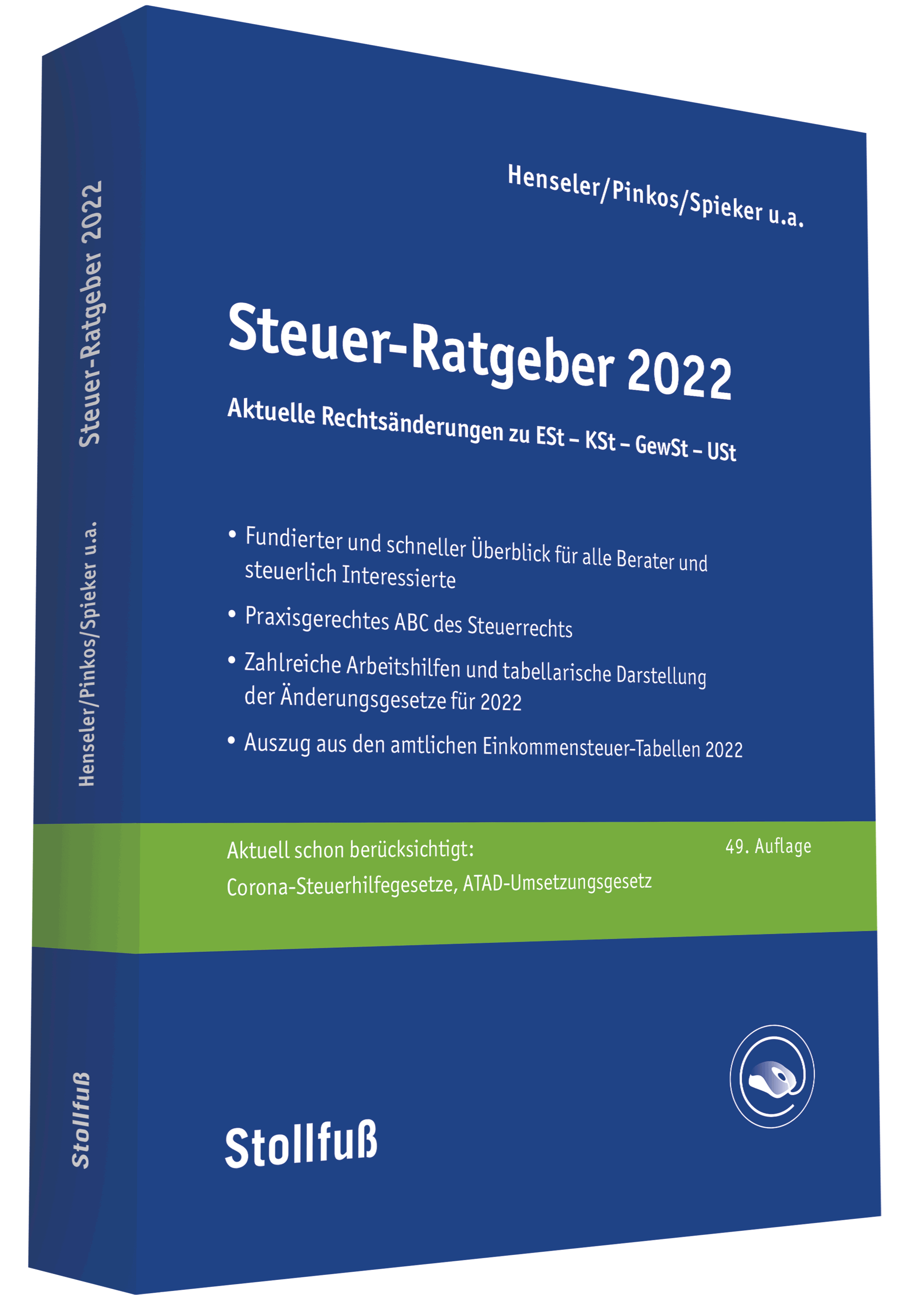Versand: 35,51 €
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG)
Preise zzgl. MwSt
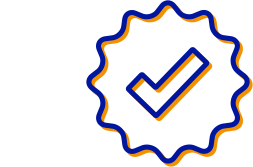
Die Vorteile der EFG Zeitschrift
- Umfassend informiert mit dem Online-Zugang zur Datenbank der EFG Zeitschrift
- Kommentierungen, Gestaltungshinweise und Beispiele zu den Rechtsprechungen
- Kostenloser Download der Einzelhefte via App
Welche Bedeutung haben die Entscheidungen der Finanzgerichte?
Die Entscheidungen der Finanzgerichte sind ein Indikator dafür, wie sich die Rechtsprechung im Steuerrecht fortentwickelt. Für Sie kommt es darauf an, alle für die Beratungspraxis wesentlichen Finanzgerichts-Entscheidungen auf dem Radar zu haben, auch aus Haftungsgründen.
Das Konzept der EFG Zeitschrift:
- Die Auswahl der Entscheidungen: Die stets aktuellen Entscheidungen der Finanzgerichte sind von einer hochqualifizierten Redaktion aus erster Hand nach ihrer Relevanz für die Beratungspraxis ausgewählt.
- Die Aufbereitung der Gerichtsentscheidungen: Ein aussagekräftiger Leitsatz bildet die Quintessenz. Die Entscheidungsgründe konzentrieren sich auf die tragenden Gründe, ergänzt um Zwischenüberschriften.
- Die Kommentierung der Entscheidungen: Alle Entscheidungen werden in den EFG-Zeitschriften hochkarätig kommentiert. Es werden weiterführende Anmerkungen vorgenommen sowie Arbeitshilfen in Form von Gestaltungshinweisen und Beispielen aufgeführt.
Der Zugang zur Online-Datenbank:
Der Zugang zur Online-Datenbank der EFG stellt sämtliche Ausgaben seit dem Jahrgang 1995 digital zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem:
- Volltexte der zitierten Gesetze und Rechtsprechungsquellen
- uneingeschränkter Zugriff auf die wöchentlichen eNews Steuern
- E-Mail-Pushdienst und viele weitere Online-Funktionen
Aktuelles aus Heft 1 der EFG (Januar 2026) u.a.
Unmittelbare Verwendung eines Riester-Guthabens in Herstellungsfällen
Das FG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 2.9.2025 (15 K 15101/24) zur unmittelbaren Verwendung eines Riester-Guthabens in Herstellungsfällen entschieden. Die Richterin am FG Dr. Ulrike Hoffsümmer kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
I. Sachverhalt
Die Klin beantragte im Oktober 2021 die Entnahme geförderten Altersvorsorgevermögens aus ihrem Riester-Bausparvertrag. Dabei gab sie an, dass sie ab voraussichtlich Oktober 2023 ein neu hergestelltes Haus selbst nutzen werde. Sie habe einen Bauträgervertrag geschlossen, in dem sich der Bauträger zu einer Fertigstellung spätestens am 30.12.2023 verpflichtet habe.
Im November 2021 erließ die Bekl. einen antragsgemäßen Gestattungsbescheid nach § 92b Abs. 1 Satz 3 EStG, in dem sie der Klin. mitteilte, bis zu welcher Höhe eine wohnungswirtschaftliche Verwendung i.S. des § 92a Abs. 1 Satz 1 vorliegen könne. Die Auszahlung aus dem Riester-Bausparvertrag erfolgte im November 2021. Das Geld wurde zeitnah für die Zahlung von Herstellungskosten der in Bau befindlichen Immobilie verwendet.
Auf eine Anfrage aus September 2023 teilte die Klin. der Bekl. mit, dass das Objekt noch nicht fertiggestellt sei und dass sie Nachweise über die Aufnahme der Selbstnutzung voraussichtlich im Januar 2024 einreichen werde. Mit Bescheid vom 21.2.2024 erließ die Bekl. einen Rückforderungsbescheid nach § 94 Abs. 2 EStG. Es liege eine schädliche Verwendung des ausgezahlten Betrags vor, weil die Selbstnutzung nicht innerhalb von zwölf Monaten und damit nicht unmittelbar aufgenommen worden sei.
II. Rechtslage
Die staatliche Riester-Förderung kann durch das sog. „Wohn-Riester“ u.a. auch für den Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie in Anspruch genommen werden. Gemäß § 92a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG kann der Zulageberechtigte das in einem Altersvorsorgevertrag gebildete und nach § 10a EStG oder nach §§ 79 ff. EStG geförderte Kapital, den sog. Altersvorsorge-Eigenheimbetrag, bis zum Beginn der Auszahlungsphase unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen ganz oder teilweise unmittelbar für die Anschaffung oder Herstellung einer Wohnung oder zur Tilgung eines zu diesem Zweck aufgenommenen Darlehens verwenden. Begünstigte Objekte sind dabei insbesondere im Inland belegene selbstgenutzte Wohnungen.
Bislang ist nicht höchstrichterlich geklärt, wann in Herstellungsfällen eine unmittelbare Verwendung i.S. des § 92a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG gegeben ist. Das BFH-Urteil vom 16.2.2022 X R 26/20 (BStBl II 2022, 611) betraf die unmittelbare Verwendung von Riester-Kapital in Fällen der Darlehenstilgung. Die Verwaltung vertritt – ohne zwischen Anschaffung, Herstellung und Darlehenstilgung zu differenzieren – die Auffassung, dass von einer unmittelbaren Verwendung auszugehen sei, wenn innerhalb von sechs Monaten vor Antragstellung bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen und bis zwölf Monate nach Auszahlung des geförderten Altersvorsorgekapitals entsprechende Aufwendungen für eine begünstigte Verwendung entstanden sind (BMF-Schreiben vom 5.10.2023 IV C 3 – S 2015/22/10001 :001, BStBl I 2023, 1726, Rz. 258).
III. Die Entscheidung des FG
Das FG hat der Klage stattgegeben. Die Bekl. sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Klin. innerhalb von zwölf Monaten nach Auszahlung des geförderten Altersvorsorgekapitals die Wohnung hätte beziehen müssen. Das Erfordernis der Unmittelbarkeit i.S. des § 92a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG beziehe sich nicht nur auf das Tätigen von Aufwendungen zur Anschaffung oder Herstellung, sondern auch darauf, dass es sich um eine selbstgenutzte Wohnung i.S. des § 92a Abs. 1 Satz 5 EStG handele. Dabei müsse das Förderobjekt nicht innerhalb einer starren Zeitgrenze fertiggestellt werden. Das Unmittelbarkeitserfordernis sei in Herstellungsfällen nicht dahingehend zu verstehen, dass auch die Selbstnutzung i.S. von § 92a Abs. 1 Satz 5 EStG innerhalb eines Zeitrahmens von sechs Monaten vor Antragstellung und zwölf Monaten nach Auszahlung vorliegen müsse.
Nach Auffassung des Gerichts müsse in Herstellungsfällen die Absicht des Zulageberechtigten, nach planmäßigem Bau die Nutzung aufzunehmen, fortbestehen und sich in objektiven Umständen manifestieren. Erfolge eine Herstellung in angemessener Zeit und werde das Objekt nach Fertigstellung vom Berechtigten selbstgenutzt, sei von einer von Anfang an bestehenden Selbstnutzungsabsicht auszugehen. Zur Begründung hat das Gericht Vergleiche zur steuerlichen Behandlung von Fällen, in denen sich eine beabsichtigte Nutzung einer Immobilie verzögert, im Bereich der Erbschaftsteuer (§ 13 ErbStG) sowie zu früheren Regelungen zur staatlichen Wohnförderung (§ 10e und § 10i EStG a.F.) angestellt.
IV. Einordnung und Würdigung der Entscheidung
Die Entscheidung befasst sich mit der Auslegung des Tatbestandsmerkmales „unmittelbare“ Verwendung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags für die Herstellung einer Wohnung. Dabei hat das Gericht herausgestellt, dass berücksichtigt werden müsse, dass es in Herstellungsfällen zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann, auf die der Berechtigte keinen Einfluss hat.
Mit überzeugenden Gründen hat das Gericht entschieden, dass die Verwendung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags für die Herstellung von Wohneigentum nicht nur die zeitnahe Verwendung des ausgezahlten Kapitals zur Bezahlung der Herstellungskosten voraussetzt, sondern auch die tatsächliche Selbstnutzung der hergestellten Wohnung nach ihrer Fertigstellung. Der Auffassung des Gerichts, dass der Berechtigte die begünstigte Wohnung nicht innerhalb einer starren Zeitgrenze nach Kapitalauszahlung beziehen muss, ist zuzustimmen. Das Gesetz enthält keine solche zeitliche Vorgabe.
V. Hinweise für die Praxis
Für Herstellungsfälle, in denen ein Riester-Vertrag in die Finanzierung eingebunden werden soll, hat die Entscheidung erhebliche Bedeutung. Banken und Bausparkassen verlangen bei Immobilienfinanzierungen regelmäßig, dass Eigenkapital (und damit auch das zuvor in einem Riester-Vertrag angesammelte Kapital) zu Beginn der Bauphase eingesetzt wird. Vor diesem Hintergrund dürfte es der Normalfall sein, dass zwischen der Auszahlung und der Fertigstellung des Objekts ein längerer Zeitraum liegt. Ein Überschreiten der von der Bekl. angenommenen Jahresfrist zwischen Kapitalauszahlung und Einzug in die fertiggestellte Wohnung, zu der es v.a. bei ungeplanten Bauverzögerungen leicht kommen kann, würde in einer Vielzahl von Fällen zu einer Rückforderung und damit zu einer nachträglichen Versagung der staatlichen Förderung führen.
Soweit ersichtlich wurde die vom FG zugelassene Revision nicht eingelegt. Mit einer höchstrichterlichen Klärung der Frage, wann der Einzug in Herstellungsfällen erfolgen muss, ist daher vorerst nicht zu rechnen. Die Verwaltung wird folglich an ihrer im BMF-Schreiben vom 5.10.2023 IV C 3 – S 2015/22/10001 :001 (BStBl I 2023, 1726, Rz. 258) geäußerten Auffassung festhalten und weiterhin fordern wird, dass zwischen Kapitalauszahlung und Bezug der hergestellten Wohnung nicht mehr als zwölf Monate vergehen.
Betroffene können sich in ähnlich gelagerten Fällen in Einspruchs- und Klageverfahren auf die für sie günstige Entscheidung des FG Berlin-Brandenburg berufen. Sie werden dann aber ggf. darlegen und auch nachweisen müssen, aus welchen Gründen ein tatsächlicher Einzug nicht früher möglich war und sie diese Gründe nicht zu vertreten haben.
Aktuelles aus Heft 24 der EFG (Dezember 2025) u.a.
Keine Rückwirkung des neuen Forschungszulagengesetzes
Das FG Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 14.3.2025 (5 K 2302/24) zur Rückwirkung des neuen Forschungszulagengesetzes entschieden. Der Richter am FG Dr. Michael Hennigfeld kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
I. Problemstellung
Streitig war die Höhe der festzusetzenden Forschungszulagen nach dem FZulG. Die Klägerin ist eine GmbH und ein kleines Unternehmen i.S. des Anlage 1 der AGVO. 2023 stellte die Klägerin Anträge auf Forschungszulagen für die Wj. 2021 und 2022, die 2023 antragsgemäß unter dem Vorbehalt der Nachprüfung beschieden wurden, wobei jeweils 25 % der BMG in Ansatz gebracht wurden. Am 17.5.2024 beantragte die Klägerin entsprechend der Neufassung des § 4 Abs. 1 Satz 2 FZulG durch das Wachstumschancengesetz vom 28.3.2024 eine Änderung der Bescheide unter Berücksichtigung einer BMG von jeweils 35 %. Der Gesetzgeber habe mit dem Wachstumschancengesetz die Forschungszulage entsprechend erhöht. Dem folgte das Finanzamt nicht. Hiergegen richtete sich die Klage. Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass die erhöhte Forschungszulage in allen bei Inkrafttreten des Wachstumschancengesetzes offenen Fällen zu gewähren sei.
II. Die Entscheidung des FG
Das FG hat die Klage abgewiesen. Durch das WaChaG vom 28.3.2024 sei § 4 Abs. 1 Satz 2 FZulG dahingehend ergänzt worden, dass KMU auf Antrag eine Forschungszulage i.H.v. 35 % der BMG erhalten könnten. Aus einer Gesamtschau des Förderverfahrens und der Normen ergebe sich, dass Forschungszulagen für Sachverhalte in der Vergangenheit gewährt würden und die nachträgliche Erhöhung des Bemessungssatzes nur für nach dem Inkrafttreten des Wachstumschancengesetzes entstandene förderfähige Aufwendungen gelten könne. Dass die Neuregelung auch für bereits verwirklichte Sachverhalte und in allen offenen Fällen gelten solle, dafür gebe es weder im Wortlaut des Gesetzes noch in der amtlichen Begründung einen Hinweis. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Gesetzgeber Mitnahmeeffekte gerade habe vermeiden wollen und nur künftige Forschungsaufwendungen habe gesondert fördern wollen. Ansonsten gäbe es ohne sachlichen Grund eine nicht gerechtfertigte Vergünstigung derjenigen Unternehmen, deren Veranlagungen noch offen gewesen seien. Hierfür hätte es einer ausdrücklichen Regelung bedurft.
III. Hinweise für die Praxis
Das FG hat die Revision zugelassen. In der Literatur wird zur zeitlichen Anwendbarkeit der Neuregelung die gegenteilige Auffassung vertreten. Da es hinsichtlich des erhöhten Förderersatzes an einer konkreten Anwendungsregelung fehle, spreche vieles dafür, dass die Neuregelung in alle noch offenen Fällen anzuwenden sei. Hierfür spreche als Gegenbeispiel § 4 Abs. 2 FördG (Bergan/Lätsch, DStR 2024, 705, 724; Korn, kösdi 2024, 23841, 23853). Es bleibt abzuwarten, ob der BFH im Rahmen eines Revisionsverfahrens Gelegenheit bekommt, die Streitfrage höchstrichterlich zu klären. Dem FG ist im Besprechungsfall allerdings zuzugeben, dass die in der Lit. vertretene Auffassung eine sachlich nicht begründbare Besserstellung solcher Unternehmen zur Folge hätte, deren Veranlagungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WaChaG noch offen waren, ohne dass dies unter Berücksichtigung des Förderzieles in irgendeiner Weise begründbar wäre.
Aktuelles aus Heft 23 der EFG (Dezember 2025) u.a.
Grenzgänger – Berechnung der schädlichen Tage bei Dienstreisen
Das FG des Saarlandes hat mit Urteil vom 10.4.2025 (2 K 1149/21) zur Berechnung der schädlichen Tage bei Dienstreisen von Grenzgängern entschieden. Die Präsidentin des FG Dr. Anke Morsch kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
I. Problemstellung
Streitig war, ob die Arbeitnehmer der Klin. Grenzgänger i. S. des DBA-Frankreich waren. Dabei ging es insbesondere um die Berechnung der schädlichen Nichtrückkehrtage bei Dienstreisen in einen Drittstaat.
II. Die Entscheidung des FG
Das FG hat der Klage nur teilweise stattgegeben. Das FG konnte dahinstehen lassen, ob § 7 Abs. 5 KonsVerFRAV, wonach bei mehrtägigen Dienstreisen die Tage der Hinreise sowie der Rückreise stets zu den Nichtrückkehrtagen gehören (§ 7 Abs. 3 KonsVerFRAV), der als Arbeitstage die vertraglich vereinbarten Arbeitstage sowie alle weiteren Tage, an denen der Arbeitnehmer (darüber hinaus) seine Tätigkeit ausübt, definiert, einschränkt. Offenbleiben konnte auch, ob der Senat an die Regelung in § 7 Abs. 5 KonsVerFRAV gebunden wäre. Die Hin- und Rückreisen zu den mehrtägigen Dienstreisen der genannten Arbeitnehmer führten nämlich bereits deshalb zu Nichtrückkehrtagen, weil die Arbeitnehmer sämtliche Reisetage, auch soweit sie auf ein Wochenende entfielen, im Zeiterfassungssystem erfasst haben und ihnen im Umfang der erfassten Zeitkontingente Freizeitausgleich zustand. Dies gilt auch dann, wenn die Reisezeit nach den arbeitsvertraglichen Regelungen nicht in vollem Umfang als Zeitkontingent erfasst wird.
Mit dem Begriff der „unselbständigen Arbeit“ in Art. 15 OECD-MA und mit dem – in diesem Kontext gleichbedeutenden (Schwenke in Wassermeyer, DBA, Art. 15 OECD-MA Rz. 53) – Begriff der „nichtselbständigen Arbeit“ in Art. 13 DBA-Frankreich ist nicht nur die in physischer Präsenz ausgeübte „originäre Arbeit“ gemeint. Eine solche Einschränkung lässt sich auch dem von der Klin. zitierten Wortlaut der Musterkommentierung zu Art. 15 OECD-MA nicht entnehmen. Die Formulierung „the activities for which the employment income is paid“ in § 1 der Musterkommentierung zu Art. 15 des OECD-MA (abgedruckt in Wassermeyer, DBA, Art. 15 OECD-MA) bestätigt vielmehr umgekehrt, dass auch im abkommensrechtlichen Kontext zu den „Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit“ in Art. 13 DBA-Frankreich die Vergütung des Arbeitgebers für Reisezeit gehört. Der Vergütung steht die Erfassung der Reisezeit im Zeiterfassungssystem mit der Möglichkeit des Freizeitausgleichs gleich.
III. Hinweise für die Praxis
Die Berechnung der schädlichen Tage bei Dienstreisen gehört im Zusammenhang mit Grenzgängerregelungen zu den wiederkehrenden Problemen. Das FG hat die Revision zugelassen. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass das Verfahren auch geführt wurde. Die Frage, ob und in welchen Fällen Reisetage an einem Wochenende als Nichtrückkehrtage i. S. des Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich gelten, ist damit nach wie vor höchstrichterlich noch nicht entschieden.
Aktuelles aus Heft 22 der EFG (November 2025) u.a.
Überlagernde Richtwertzonen bei der Grundsteuerwertfeststellung
Das FG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 10.9.2025 (3 K 3109/24) zu überlagernden Richtwertzonen bei der Grundsteuerwertfeststellung entschieden. Der Richter am FG Dr. Marius Schumann kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
I. Entscheidungserheblicher Sachverhalt
Es geht um die Grundsteuerwertfeststellung für ein Grundstück, welches in deckungsgleich überlagernden Bodenrichtwertzonen belegen ist. Eine Zone ist für den Entwicklungszustand baureifes Land und die Nutzungsart W – Wohnbaufläche vorgesehen, die andere Zone (mit einem erheblich niedrigeren Bodenrichtwert) für den Entwicklungszustand sonstige Flächen und die Nutzungsart S-WO – Sonderbaufläche – Wochenendhäuser. Das Bewertungsobjekt ist mit einem (legal errichteten) Einfamilienhaus bebaut, welches (ebenfalls legal) ganzjährig zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Weil der Bekl. eine Teil-Einspruchsentscheidung erlassen hat, war die Frage der Verfassungsmäßigkeit des neuen grundsteuerlichen Bewertungsrechts nicht Entscheidungsgegenstand des Besprechungsurteils.
II. Die Entscheidung des Gerichts
Die Kernfrage war zunächst, welcher Bodenrichtwert heranzuziehen war. Das FG hat das Bewertungsobjekt sowohl dem Entwicklungszustand baureifes Land als auch der Nutzungsart Wohnbaufläche zugeordnet, so dass der höhere der beiden in Betracht kommenden Bodenrichtwerte heranzuziehen war. Dabei hat das FG jeweils auf die legal vorhandene Bebauung und die legal praktizierte tatsächliche Nutzung abgestellt. Unmaßgeblich war nach Auffassung des FG, ob
- ein Neubau nach einem gedachten Abriss zulässig wäre,
- das Grundstück bauplanungsrechtlich im Außenbereich liegt,
- das Grundstück in einem Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen ist,
- Tiefbaumaßnahmen zulässig sind,
- die Zuwegung über befestigte oder unbefestigte Wege verläuft,
- es einen Kanalisationsanschluss oder nur eine Abwasserentsorgung über Sammelgruben gibt,
- der Eigentumserwerb der Kl. auf dem SachenRBerG beruhte,
- sich das Objekt mitten in der früheren Kleingartenanlage
- oder an ihrem Rand befindet,
- andere Häuser der Umgebung bloße Wochenendhäuser sind.
Für die Praxis interessant sind auch die Ausführungen zu der Frage, wie die Restnutzungsdauer im Falle von Kernsanierungen (§ 253 Abs. 2 Satz 4 BewG) zu bestimmen ist. Hier hat das FG sich der Verwaltungsauffassung (Abschn. 253.1 Abs. 3 AEBewGrSt) angeschlossen, wonach vom Jahr der Kernsanierung als neuem maßgeblichen Baujahr auszugehen und die Restnutzungsdauer im Jahr der Kernsanierung aus Vereinfachungsgründen im Wege einer sachgerechten Schätzung (§ 162 AO) auf 90 % der typisierten Gesamtnutzungsdauer zu bemessen ist.
III. Weiterführende Hinweise
Da unterschiedliche Entwicklungszustände nicht nur in Fällen überlagernder Bodenrichtwertzonen (ausdrücklich im Gesetz nur hinsichtlich unterschiedlicher Nutzungsarten geregelt, § 247 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BewG), sondern auch bei Vorliegen nur einer räumlich einschlägigen Bodenrichtwertzone berücksichtigungsfähig sind (§ 247 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BewG), ist damit zu rechnen, dass hier in zukünftigen finanzgerichtlichen Verfahren noch öfter die Musik spielen wird. Wenn ein Zonen-Bodenrichtwert nur für baureifes Land ermittelt worden ist, das Bewertungsobjekt aber einen abweichenden Entwicklungszustand aufweist, ist der Weg zu einer (regelmäßig zu einem niedrigeren Wert führenden) Ableitung nach § 247 Abs. 3 BewG eröffnet (vgl. FG Düsseldorf, Beschluss vom 9.1.2025 11 V 2128/24 A (BG), EFG 2025, 499; FG Düsseldorf, Urteil vom 22.5.2025 11 K 2040/24 Gr, BG, juris). Hier bedarf es u. U. einer vertieften Auseinandersetzung mit den Vorgaben von § 3 ImmoWertV.
Aktuelles aus Heft 21 der EFG (November 2025) u.a.
Rückwirkender Wegfall der Gemeinnützigkeit wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Vermögensbindung
Das FG Münster hat mit Urteil vom 29.11.2023 (13 K 1127/22 K) zum rückwirkenden Wegfall der Gemeinnützigkeit wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Vermögensbindung entschieden. Der Richter am FG Dr. Ingo Oellerich kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
I. Problemaufriss
Die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG setzt nicht nur eine ordnungsgemäße Satzung, sondern insbesondere auch eine ordnungsgemäße Geschäftsführung voraus, durch die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt werden. Auch wenn eine Stiftung zunächst ihre gemeinnützigen Zwecke verwirklicht, können sich Probleme ergeben, wenn sie von Todes wegen gegründet worden ist und das bei Gründung übertragene Vermögen mit einem Vermächtnis beschwert ist, das die Stiftung zu einer unabsehbar langdauernden fixen Rentenzahlung verpflichtet. Wird nicht bereits bei der Gründung dadurch Vorsorge getroffen, dass das Vermächtnis der Höhe nach beschränkt wird, kann sich bei einer schlechten Entwicklung der Stiftungserträge die Gefahr ergeben, dass die Stiftung nicht mehr in der Lage ist, einerseits ihre gemeinnützigen Ziele zu verfolgen und andererseits die Rente zu zahlen. Zahlt die Stiftung weiterhin die Rente und kann daneben voraussichtlich dauerhaft die gemeinnützigen Ziele nicht mehr verfolgen, stellt sich die Frage nach den Auswirkungen für die Gemeinnützigkeit, da die Stiftung im Ergebnis nur noch allein privatnützigen Interessen, nämlich der Unterhaltung des Rentenberechtigten dient.
In dem Fall der Besprechungsentscheidung kam noch hinzu, dass die Bezirksregierung die Stiftung aufgelöst hatte, weil diese ihre Stiftungszwecke voraussichtlich dauernd und nachhaltig nicht mehr erfüllen konnte, und auch anschließend der Liquidator das Stiftungsvermögen nicht an den gemeinnützigen Y e. V. auskehrte, weil er meinte, noch die Rentenverpflichtung bis zum Tod der DZ erfüllen zu müssen. Dies führte aber prognostisch zu einem vollständigen Verzehr des Stiftungsvermögens bis 2037 allein auf Grund von Rentenzahlungen. Das war Anlass für das FA, gem. § 61 Abs. 3 AO zehn Jahre rückwirkend Körperschaftsteuerbescheide zu erlassen, weil der Grundsatz der Vermögensbindung verletzt worden sei.
II. Die Entscheidung des FG
Das FG Münster stützte im Ergebnis die Rechtsauffassung des FA. Zwar sah auch das FG, dass zunächst einmal das Vermögen bereits vor Errichtung der Stiftung nur mit einem Vermächtnis belastet worden war und damit allein das belastete Vermögen in das Stiftungsvermögen gelangt war. Es stieß sich aber im Ergebnis daran, dass durch das Vermächtnis eine Rentenverpflichtung begründet worden war, die lebenslang bis zum Tod der Berechtigten bestand und keinerlei Sicherungen eingezogen worden waren, um zu garantieren, dass das Stiftungsvermögen im ungünstigen Fall nicht allein dazu dienen würde, das individualnützige Vermächtnis zu erfüllen. Aber nicht nur das: Im Streitfall kam hinzu, dass die Klin. nicht einmal fünf Jahre nach ihrer Auflösung das Stiftungsvermögen an die in diesem Fall begünstigte Körperschaft, einen gemeinnützigen Verein, auskehren wollte, weil das Vermächtnis erfüllt werden sollte.
III. Einordnung und Würdigung der Entscheidung
Das FG hatte keinen Anlass gesehen, die Revision zuzulassen. Dies ist erst durch BFH-Beschluss vom 30.7.2025 V B 3/24 (n. v.) geschehen; die Revision wird unter dem Az. V R 27/25 geführt. Der BFH führte aus, die Revision werde zur Klärung der Rechtsfragen zugelassen, ob (1) die Auflösung oder Aufhebung einer Körperschaft und der Eintritt in die Liquidation bereits für sich genommen zum Verlust der Steuerbefreiung des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG führen sowie ob (2) im Fall der Auflösung oder Aufhebung einer Körperschaft § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO gem. § 61 Abs. 3 Satz 2, § 63 Abs. 2 AO mit der Maßgabe anzuwenden sei, dass Steuerbescheide erlassen, aufgehoben oder geändert werden können, soweit sie Steuern betreffen, die innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre vor der Auflösung oder Aufhebung entstanden sind.
Es überrascht, welche Rechtsfragen der BFH angesichts des konkreten Einzelfalls meint klären zu müssen. Das FG Münster hat nämlich keinesfalls entschieden, dass allein die Auflösung oder Aufhebung der Stiftung bereits das Ereignis war, das zu einem rückwirkenden Erlass von Körperschaftsteuerbescheiden für die vergangenen zehn Jahre geführt hat. Vielmehr betont das FG ausdrücklich die Kumulation der verschiedenen Schwierigkeiten, die im konkreten Fall zusammentrafen: Zunächst einmal vermachten die Eheleute Z ihrer Tochter eine monatlich fortlaufende Rentenverpflichtung, die weder zeitlich noch hinsichtlich der Höhe limitiert war, sondern im Gegenteil lebenslang zu erfüllen war. Und dies sollte auch dann noch gelten, wenn sich die Ertragslage zu Lasten der Stiftung so verfestigt hätte, dass zur Erfüllung der Rente nicht nur sämtliche Erträge verwendet, sondern auch der Vermögensstamm angegriffen werden musste. Entscheidend kam aber hinzu, dass die Stiftung deshalb nicht nur von der Bezirksregierung aufgelöst wurde, sondern sich der Liquidator auch nicht in der Lage sah, das Stiftungsvermögen an den gemeinnützigen e. V. auszukehren, um jedenfalls insoweit zu einer gemeinnützigen Mittelverwendung zurückzukehren. Prognostisch drohte vielmehr bei einem ungehinderten Fortgang allein für die Erfüllung der Rentenverpflichtung das Stiftungsvermögen bis 2037 aufgezehrt zu werden. Der bei Auflösung als Anfallsberechtigter vorgesehener Y e.V. hätte daher nach dem eigenen Vortrag des Liquidators voraussichtlich nichts erhalten.
Wenn man den Schluss des FG mitgeht, dass in diesem konkreten (und wohl auch speziell gelagerten) Fall ein Verstoß gegen den Grundsatz der Vermögensbindung vorliegt, ist der rückwirkende Erlass von Körperschaftsteuerbescheiden für die vergangenen zehn Jahre zwangsläufig. Das sieht § 61 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 63 Abs. 2 AO ausdrücklich so vor.
Aktuelles aus Heft 20 der EFG (Oktober 2025) u.a.
Einheitliches Vertragswerk; Herabsetzung der Gegenleistung nach insolvenzbedingter Kündigung des Bauvertrages und Auswechslung des Bauunternehmers
Das FG München hat mit Urteil vom 21.5.2025 (4 K 895/23) zur Herabsetzung der Gegenleistung nach insolvenzbedingter Kündigung des Bauvertrages und Auswechslung des Bauunternehmers entschieden. Der Richter am FG Dr. Daniel Aschenbrenner kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
I. Sachverhalt
Der Senat hatte im Streitfall zu entscheiden, ob eine Herabsetzung nach § 16 Abs. 3 GrEStG vorliegt, wenn die Kl. im Rahmen eines einheitlichen Vertragswerks zwar den Bauvertrag kundigen, im Ergebnis aber unverändert an dem vereinbarten einheitlichen Vertragswerk festhalten und das Grundstuck entsprechend der ursprünglichen Vereinbarung in bebautem Zustand erhalten.
II. Entscheidung des FG
Zwar ist durch den BFH geklärt, dass eine Herabsetzung der Gegenleistung nach § 16 Abs. 3 GrEStG vorliegen kann, wenn ein Bauerrichtungsvertrag nach nur teilweiser Erfüllung aufgehoben bzw. gekündigt wird (BFH-Urteil vom 10.8.1994 II R 29/91, BFH/NV 1995, 260). Die Rechtsfolge des § 16 Abs. 3 GrEStG tritt aber nur ein, wenn der Erwerber auf Grund der Aufhebung des Gebäudeerrichtungsvertrags in seiner Entscheidung über die Vergabe der zur Fertigstellung des Gebäudes noch notwendigen Bauleistungen wieder völlig frei geworden ist (BFH-Urteil vom 10.8.1994 II R 29/91, BFH/NV 1995, 260). Eine Aufhebung der Bindung des Erwerbers kann im Fall einer Insolvenz der auf der Veräußererseite auftretenden Personen eintreten (dazu z.B. BFH-Urteil vom 14.3.1990 II R 169/87, BFH/NV 1991, 263). Eine Aufhebung der Bindung des Erwerbers tritt jedoch dann nicht ein, wenn mit der Auswechslung der Person des Bauunternehmers der Erwerber seiner Bindung an das ihm unterbreitete einheitliche und als solches angenommene Angebot Rechnung tragt, dieses von vornherein die Vergabe des Bauauftrags durch den Erwerber selbst vorgesehen hat und der Erwerber durch die Erteilung des Bauauftrags an einen anderen Bauunternehmer dem entsprochen und in Fortführung des von ihm einheitlich angenommenen Angebots gehandelt hat (BFH-Urteil vom 31.3.2004 II R 62/01, juris).
Nach Auffassung des Senats liegen im Streitfall die Voraussetzungen für eine Herabsetzung nicht vor. Zwar wurden die Kl. durch die Kündigung des Bauvertrages zivilrechtlich in der Wahl des Bauunternehmers wieder frei. Nach Ansicht des Senats kommt es jedoch zusätzlich darauf an, dass sich der Erwerber auch in tatsächlicher Hinsicht (faktisch) von dem einheitlichen Vertragswerk gelost hat. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall, da die Veräußererseite den neuen Bauunternehmer ausgesucht, dessen Angebot an den Erwerber ausgehandelt, dafür Sorge getragen hat, dass für die Erwerber wegen der Auswechslung des Bauunternehmers keine Nachteile entstehen, insbesondere, dass sich der Gesamtpreis für Grundstuck samt Gebäude nicht erhöht und die Erwerber dieses Angebot im Wesentlichen unverändert angenommen haben. Die Erwerber handelten daher in Fortführung des von ihm ursprünglich einheitlich angenommenen Angebots.
III. Bewertung und Ausblick
Die Revision wurde zugelassen, da bislang durch den BFH nicht unmittelbar geklärt ist, ob die Voraussetzungen für eine Herabsetzung nach § 16 Abs. 3 GrEStG erfüllt sind, wenn durch die Erwerb im Rahmen eines einheitlichen Vertragswerks lediglich die zivilrechtliche Bindung an den Bauvertrag wegfallt, der Erwerb des Grundstücks in bebautem Zustand durch Auswechslung des Bauunternehmens dadurch aber nicht verändert wird. Angesichts der Zunahme an Insolvenzen von Bauunternehmen infolge der Zinswende und der Baupreisinflation seit dem Jahr 2022 durfte der Entscheidung zunehmende Praxisrelevanz zukommen.
Aktuelles aus Heft 19 der EFG (Oktober 2025) u.a.
Steuerliche Behandlung der Rückzahlung einer Corona-Soforthilfe bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG
Das Niedersächsische FG hat mit Urteil vom 13.2.2024 (12 K 20/24) zur steuerlichen Behandlung der Rückzahlung einer Corona-Soforthilfe bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG entschieden. Die Vorsitzende Richterin am FG Prof. Dr. Susanne Tiedchen kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
I. Sachverhalt
Der Kl., der als Soloselbstständiger seinen Gewinn gem. § 4 Abs. 3 EStG durch Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt, erhielt im Jahr 2020 eine Corona-Soforthilfe, die er als Betriebseinnahme versteuerte, die er aber im Jahr 2023 zum größten Teil zurückzahlen musste.
II. Rechtsauffassungen
Der Kl. war der Auffassung, dass die Corona-Soforthilfe, die „unter dem Vorbehalt der Rückzahlung“ gewährt worden sei, ein Darlehen und keine Betriebseinnahme darstelle. Zudem führte er die Änderungsmöglichkeit des angefochtenen Bescheides gem. § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO ins Feld. Der Bekl. hingegen verwies auf das für die Gewinnermittlung gem. § 4 Abs. 3 EStG geltende Zu- und Abflussprinzip.
III. Die Entscheidung des FG
Das FG hat die Klage abgewiesen. Es sah in der Corona-Soforthilfe, die unstreitig im Streitjahr zugeflossen war, eine Betriebseinnahme, da sie durch die betriebliche Tätigkeit veranlasst war und die Leistungsfähigkeit des Kl. erhöht hatte. Der Annahme eines Darlehens stand aus der Sicht des FG entgegen, dass die Rückzahlungsverpflichtung nicht von vorneherein feststand, sondern von Umständen abhing, auf die der Leistende keinen Einfluss hatte.
Das FG sah die Rückforderung der Corona-Soforthilfe auch nicht als ein rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO an, sondern als ein neues Ereignis, das sich steuerlich im Jahr der Rückzahlung auswirkte.
Schließlich verneinte das FG auch eine Steuerfreiheit der Corona-Soforthilfe nach § 3 Nr. 2 Buchst. d oder § 3 Nr. 11 EStG.
IV. Einordnung und Würdigung der Entscheidung
Es überrascht, dass ein Fall wie der hier zu entscheidende offenbar noch nie Gegenstand eines finanzgerichtlichen Verfahrens war. Das FG hatte hier also Neuland zu betreten. Das Ergebnis liegt auf der Linie der FinVerw. (vgl. Landesamt für Steuern Niedersachsen, Verfügung vom 8.3.2022 S 2137-206-St221/St224; FinMin. Schleswig-Holstein, Kurzinfo vom 18.10.2021 VI 304-S 2137-347, ESt-Kurzinformation 2021/23, jeweils unter 3.) und erscheint auch überzeugend. Die Annahme eines Darlehens ist ausgesprochen fernliegend, und auch die Erwägung der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 2 Buchst. d EStG (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch) oder nach § 3 Nr. 11 EStG (Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln einer öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck bewilligt werden, die Erziehung oder Ausbildung, die Wissenschaft oder Kunst unmittelbar zu fördern) dürften nur äußerst vorsorglich angesprochen worden sein.
Ernsthaft zu erwägen ist allenfalls die Frage der Rückwirkung der Rückforderung der Corona-Soforthilfe i.S. des § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO. Die Vorschrift soll die Wirkung der Abschnittsbesteuerung kompensieren. Als rückwirkende Ereignisse werden demgemäß solche Ereignisse angesehen, die ohne die rückwirkende Berücksichtigung wirtschaftlich leerliefen oder sich aus rechtstechnischen Gründen gar nicht auswirkten (Rüsken in Klein, AO, 18. Aufl. 2024, Rz. 65). Das ist hier jedoch nicht der Fall, denn die Rückzahlungsverpflichtung kann und wird im Jahr der Rückzahlung steuerlich berücksichtigt werden.
V. Hinweise für die Praxis
Auf die Nichtzulassungsbeschw. des Kl. hat der BFH die Revision zugelassen (Az. des BFH: VIII R 4/25). Das erscheint angesichts des Umstands, dass Fälle wie der hier zu entscheidende häufiger vorkommen dürften, nachvollziehbar.
Aktuelles aus Heft 18 der EFG (September 2025) u.a.
Vorliegen einer ersten Tätigkeitstätte bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
Das FG Münster hat mit Urteil vom 15.5.2025 (12 K 1916/21 F) zum Vorliegen einer ersten Tätigkeitstätte bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung entschieden. Die Richterin am FG Anke Kaufhold kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
I. Problemstellung
Die Entscheidung befasst sich insbesondere mit der Frage, inwieweit nach der Neuregelung der Entfernungspauschale in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG zum 1.1.2014 ein Vermieter an seinem Vermietungsobjekt eine erste Tätigkeitsstätte haben kann.
II. Sachverhalt
Die Klin. vermietet zwei Ferienwohnungen; ihre beiden Gesellschafter sind zudem Eigentümer einer weiteren Wohnung an demselben Ort. Im Streitjahr fuhr einer der beiden Gesellschafter der Klin. insgesamt zehnmal für mehrere Tage bis mehrere Wochen dorthin, um Reinigungs- und Renovierungsarbeiten durchzuführen. An einige Aufenthalte schloss sich ein Urlaubsaufenthalt des Gesellschafters mit seiner Ehefrau an. Das FA berücksichtigte weder Fahrkosten noch Verpflegungsmehraufwendungen oder Übernachtungskosten bei den Einkünften der Klin. aus VuV mit der Begründung, dass eine Aufteilung nicht möglich sei.
III. Die Entscheidung des Gerichts
Das FG Münster hat – ebenso wie das FG Köln im Verfahren 1 K 1209/18 (EFG 2020, 1068) – entschieden, dass am Belegenheitsort der vermieteten Immobilie jeweils eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt. Dabei hat es ausgeführt, dass entsprechend § 9 Abs. 4 Satz 4 Nr. 2 Alt. 2 EStG eine erste Tätigkeitsstätte am Vermietungsobjekt jedenfalls dann vorliege, wenn der Stpfl. mindestens 1/3 seiner regelmäßigen Arbeitszeit für das Vermietungsobjekt am Vermietungsobjekt selbst verrichte und wenn als weiteres Merkmal die Tätigkeitsstätte auch dauerhaft aufgesucht werde. Über die Dauerhaftigkeit sei in Anlehnung an die Beispiele in § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG im Rahmen einer „ex ante“-Betrachtung zu entscheiden. Darüber hinaus hat das FG Münster ausgeführt, dass die Kosten aufzuteilen seien, da zum einen unmittelbar im Anschluss an die Reparatur- und Reinigungsarbeiten Erholungsurlaube erfolgt seien und zum anderen nicht für alle zu Reparatur- und Reinigungszwecken geltend gemachten Aufenthalte hinreichend substanziiert dargetan worden sei, dass diese nicht nur in einem untergeordneten Umfang Erholungszwecken gedient hätten.
IV. Rechtliche Einordnung/Hinweis für die Praxis
Das FG Münster hat mit Blick darauf, dass keine höchstrichterliche Rspr. zu § 9 Abs. 3 EStG, wonach Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 bis 5a sowie die Abs. 2 und 4a bei den Einkunftsarten i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 7 EStG entsprechend gelten, vorliegt, die Revision zugelassen. Es ist zu hoffen, dass die Revision auch eingelegt wird, damit durch eine Entscheidung des BFH zur entsprechenden Anwendbarkeit des – auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit zugeschnittenen – § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 bis 5a sowie der Abs. 2 und 4a bei den Einkunftsarten i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 7 EStG die anzuwendenden Rechtsgrundsätze geklärt werden.
Aktuelles aus Heft 17 der EFG (September 2025) u.a.
Das FG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 12.3.2025 (16 K 3035/23) zur Anwendbarkeit des § 176 AO auf erstmaligen Erlass von Grundlagenbescheiden entschieden. Der Richter am FG Bernd Craig kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
Die Klin. hatte durch Einbringung in eine GmbH den streitigen Grundbesitz der Grunderwerbsteuer zu unterwerfen. In 2014 hatte das vorliegend nicht beklagte FA C unter Anwendung der Vorschrift des § 155 Abs. 2 i. V. m. § 162 Abs. 5 AO im Grunderwerbsteuerbescheid einen Wert für den Grundbesitz geschätzt.
Nach § 155 Abs. 2 AO kann ein Steuerbescheid erteilt werden, auch wenn ein Grundlagenbescheid noch nicht erlassen wurde. In den Fällen des § 155 Abs. 2 AO können die in einem Grundlagenbescheid festzustellenden Besteuerungsgrundlagen dabei nach § 162 Abs. 5 AO geschätzt werden. Dies hat dem nicht beklagten FA C vorliegend ermöglicht, eine Steuer festzusetzen, obwohl der eigentlich nötige Grundlagenbescheid vom örtlich zuständigen FA noch gar nicht erlassen war. Die Besonderheit des zu entscheidenden Falls bestand darin, dass vor Erlass des nunmehr streitigen Grundlagenbescheids das BVerfG eine Verfassungswidrigkeit festgestellt hatte. Der erkennende Senat hat hierauf § 176 AO angewendet, um den Stpfl. zu schützen, da der BFH in ständiger Rspr. die Auffassung vertritt, dass durch die Technik der separaten Feststellung von Besteuerungsgrundlagen dem Stpfl. weder Vorteile noch Nachteile entstehen dürfen.
Dies führte entgegen der Auffassung der Klin. zwar nicht zu einer völligen Aufhebung des streitigen Grundlagenbescheids, wohl aber zu einer deutlichen Reduzierung.
Da dieser Fall erhebliche Auswirkungen hat und soweit ersichtlich höchstrichterliche Rspr. hierzu nicht vorliegt, hat der Senat die Revision zugelassen.
Aktuelles aus Heft 16 der EFG (August 2025) u.a.
Zur Steuerfreiheit von Einkünften einer Schiedsperson
Das FG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 2.4.2025 (5 K 5031/23) zur Steuerfreiheit von Einkünften einer Schiedsperson entschieden. Die Richterin am FG Dr. Viola Gomoll kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
I. Problemstellung
Im vorliegenden Fall bestand Uneinigkeit darüber, ob die im Haushaltsplan eines Bundeslandes gewählte Bezeichnung ausgelegt werden kann und ob sich daraus ergibt, dass die an den Kl. als Vorsitzenden der Schiedsstellen gezahlten Entschädigungen als steuerfreie Aufwandsentschädigungen i.S. von § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG zu behandeln sind. Zudem wurde diskutiert, ob alternativ eine Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG in Betracht kommt, weil keine Vergütung für Dienstausfall oder Zeitverlust gewährt wurde bzw. der dem Kl. erwachsene Aufwand nicht offenbar überstiegen wurde.
II. Rechtsauffassungen
Die Kl. argumentierten, der Haushaltsplan sei auslegungsfähig, da dieser sich auf die Verordnungsermächtigungen beziehe, die Entschädigungen ausdrücklich als Aufwandsentschädigungen vorsehen. Der Wortlaut sei daher auslegungsfähig. Der Bekl. hielt dagegen, dass im Haushaltsplan die Zahlungen lediglich als „Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige“ bezeichnet seien, was eine Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG ausschließe.
Bezüglich § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG führten die Kl. an, dass der tatsächliche Aufwand durch Vorbereitung, Anreise und Durchführung der Sitzungen nicht überschritten worden sei. Der Bekl. entgegnete, dass ohne Mitwirkung der Kl. nicht feststellbar sei, ob es sich um Zahlungen für Verdienstausfall, Zeitverlust oder Reisekostenvergütungen handle.
III. Einordnung der Entscheidung des FG Berlin-Brandenburg
Das FG entschied, dass der Haushaltsplan und dessen Wortlaut keiner Auslegung zugänglich sind. Maßgeblich sei der Wille des Haushaltsplangebers, der sich mit der konkreten Bezeichnung bewusst für oder gegen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung entschieden habe. Dies ermögliche eine einheitliche Besteuerung ohne Einzelfallprüfungen. Auf Grund anderer Bezeichnungen in dem Haushaltsplan lasse sich feststellen, dass sich der Haushaltsplangeber durchaus Gedanken über die Entschädigungen gemacht habe, indem er andere Ausgaben explizit als „Aufwandsentschädigungen“ bezeichnet habe.
Zur Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG betonte das Gericht, dass der Stpfl. zur Mitwirkung verpflichtet sei. Zudem komme es auf die Rechtsgrundlage der Entschädigung an. Diese basiere auf den Verordnungsermächtigungen in § 78g Abs. 4 Nr. 3 SGB VIII und § 76 Abs. 5 SGB XI, wonach Auslagen und Zeitaufwand entschädigt werden. Aus dem Haushaltsplan selbst gehe hervor, dass die Pauschalbeträge u.a. auch Zeitaufwand abdecken sollten. Daraus schloss das FG, dass die Zahlungen für Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt wurden und damit nicht steuerfrei seien.
IV. Konsequenzen für die Praxis
Das Urteil erweitert die Kriterien zur Einordnung steuerfreier Entschädigungen. Bisher hatte der BFH mit Urteil vom 31.1.2017 IX R 10/16 (BStBl II 2018, 571) entschieden, dass Entschädigungen für ehrenamtliche Richter nicht steuerfrei sind, da sie nicht als Ersatz tatsächlicher Aufwendungen gelten und Verdienstausfall nicht steuerbefreit sind. Auch im Urteil vom 3.7.2018 VIII R 28/15 (BStBl II 2018, 715) zu Entschädigungen für einen ehrenamtlichen Versichertenberater wurde festgestellt, dass keine Aufwandsentschädigung aus einer Bundes- oder Landeskasse vorlag und diese auch dort für Zeitverlust gewährt wurde.
Zu dem Wortlaut eines Haushaltsplans sowie einer möglichen Auslegung und dem Tatbestandsmerkmal der Feststellung, dass die Aufwandsentschädigung nicht für Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt wurde oder den Aufwand des Empfängers offenbar übersteigt, musste der BFH in den dort zu beurteilenden Fällen nicht weiter Stellung nehmen.
Für die Beurteilung der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 12 EStG lässt sich festhalten, dass
- dem Wortlaut des Haushaltsplans maßgebliche Bedeutung zukommt,
- der Stpfl. für die Feststellung nach § 3 Nr. 12 Satz 2 Halbsatz 2 EStG mitwirkungsverpflichtet ist und
- die Zahlungen der jeweiligen Rechtsgrundlage zufolge nicht für Verdienstausfall oder Zeitverlust vorgesehen sein dürfen.
Aktuelles aus Heft 15 der EFG (August 2025) u.a.
Handel mit Kryptowerten
Das FG Nürnberg hat mit Urteil vom 22.1.2025 (3 K 760/22) zum Handel mit Kryptowerten entschieden. Der Richter am FG Dr. Michael Hennigfeld kommentiert die Entscheidung und gibt Hinweise für die Praxis:
I. Problemstellung
Streitig war, ob Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften beim Handel mit Kryptowerten in einer Höhe von ca. 100 000 € entstanden waren und der Einkommensteuer unterlagen. Der Kl. reichte im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 2017 eine Erklärung zu privaten Veräußerungsgeschäften ein, wonach er zum 1.1.2017 Kryptowerte für 464 854 € angeschafft und am 31.12.2017 für 566 995 € veräußert hatte. Das FA unterwarf den Veräußerungsgewinn der ESt. Hiergegen wandte sich der Kl. und trug vor, dass es sich bei Kryptowerten nicht um WG handele und daher eine Steuerpflicht nicht bestehe. Jedenfalls bestehe ein strukturelles Vollzugsdefizit, da nur ein Bruchteil der steuerpflichtigen Gewinne im Zusammenhang mit Kryptowerten erklärten. Auf Nachfrage des FA teilte der Kl. mit, dass er im Rahmen seiner Handelstätigkeiten regelmäßig Kryptowerte im Austausch gegen andere Kryptowerte gehandelt habe. Im Rahmen der Einspruchsentscheidung folgte das FA den für die Ertragsermittlung vom Kl. vorgelegten Aufstellungen und vertrat darüber hinaus die Auffassung, dass Kryptowerte als Wirtschaftsgüter einzuordnen seien und ein strukturelles Vollzugsdefizit nicht bestanden habe. Hiergegen richtete sich die Klage.
II. Die Entscheidung des FG
Das FG hat die Klage abgewiesen. Der Kl. habe durch den Handel mit Kryptowerten Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielt. Dies ergebe sich unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze, die sich aus dem Urteil des BFH vom 14.2.2023 IX R 3/22 (BStBl II 2023, 571) ergäben. Der Kl. habe mit Gewinn mit Kryptowerten (Binance Coin = BNB, Tether = USDT, MobileGo = MGO, Monaco = MCO, Stratis = STRAT, Waves = WAVES) gehandelt, bzw. solche als Gegenleistung bei der Veräußerung mit Gewinn im Tauschwege (Astronaut Token = ASTRO; Bancor = BNT; Gas = GAS; Xtrabytes = XBY) erhalten. Den Kryptowerten komme eine Wirtschaftsguteigenschaft zu. Im Hinblick auf die Gewinnermittlung sei den Aufzeichnungen des Kl. zu folgen. Soweit der Kl. die LiFo-Methode angewandt habe, stehe dies einer Berücksichtigung nicht entgegen, da zwar die FiFo-Methode als allgemeingängiger betrachtet werde, die vom Kläger gewählte Methode jedoch gesetzlich zulässig sei. Es existiere keine gesetzliche Sonderregelung wie bei Fremdwährungsgeschäften. Im Übrigen gebe es keinen Anlass, an der Richtigkeit der Angaben des Kl. zu zweifeln.
III. Hinweise für die Praxis
Das FG hat die Revision zugelassen. Die Besprechungsentscheidung enthält Hinweise zu zahlreichen Kryptowerten. In der Praxis kann für einen ersten Überblick auf die hierin enthaltenen Darstellungen zurückgegriffen werden. Im Übrigen bezieht sich die Entscheidung auf die vom BFH bereits aufgestellten Grundsätze vom 14.2.2023 in der Entscheidung IX R /22 (BStBl II 2023, 571). Hierin hat der BFH klargestellt, dass zu den Wirtschaftsgüter, die Gegenstand eines privaten Veräußerungsgeschäfts sein können, auch virtuelle Währungen gehören. Darüber hinaus hat das Gericht entschieden, dass im Rahmen der Erfassung und Besteuerung von Veräußerungsgeschäften mit virtuellen Währungen im Jahr 2017 kein normatives Vollzugsdefizit vorgelegen habe. Die FinVerw. hat mit einem BMF-Schreiben vom 10.5.2022 (BStBl I 2022, 668) zu Einzelfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von sonstigen Token Stellung genommen. Dieses Schreiben wurde mit dem BMF-Schreiben vom 6.3.2025 („Einzelfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung bestimmter Kryptowerte“) neu gefasst. Für die Verwendungsreihenfolge kann nach dem BMF-Schreiben (Rz. 61) für Zwecke der Wertermittlung unterstellt werden, dass die zuerst angeschafften Kryptowerte einer Handelsbezeichnung zuerst veräußert wurden (FiFo-Methode). Insofern ist die Aussage der Besprechungsentscheidung bedeutsam, wonach auch die LiFo-Methode für zulässig gehalten wird.
ISSN: 0421-2991
| Branche: | Steuerberatende Berufe/Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte/Notare |
|---|---|
| Erscheinungsform: |
Die Herausgeber
Herausgegeben unter Mitwirkung der Richter an den Finanzgerichten in der Bundesrepublik Deutschland.
Redaktion
Christian Wolsztynski
Harald Junker
Leseprobe
Leseprobe kostenlos herunterladen
Inhalt EFG 1/2026
Einkommensteuer
- Wohnriester-Förderung: Unmittelbarkeit der Kapitalverwendung und Selbstnutzung bei Bauverzögerungen im Herstellungsfall, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 02.09.2025, 15 K 15034/23, S. 1
- Flughafengelände als erste Tätigkeitsstätte, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18.09.2025, 14 K 14094/23, S. 8
- Zur Besteuerung von Leibrenten aus Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht – Keine unzulässige Rückwirkung durch § 52 Abs. 28 Satz 5 i. d. F. des JStG 2024, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 02.09.2025, 15 K 15051/25, S. 13
- Unmittelbare Verwendung eines Riester-Guthabens in Herstellungsfällen, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 02.09.2025, 15 K 15101/24, S. 18
Europäische Union
- Prioritätsregeln beim Kindergeld, FG Nürnberg, Urteil vom 27.06.2024, 8 K 712/23, S. 23
Finanzgerichtsordnung
- Zur aktiven Nutzungspflicht des beSt ab dem 1. 1. 2023 und zu möglichen Wiedereinsetzungsgründen, FG Baden-Württemberg, Urteil vom 30.01.2024, 6 K 533/23, S. 27
- Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Klageschrift eines Rechtsanwalts im finanzgerichtlichen Verfahren auch in eigener Sache, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 05.08.2025, 3 K 3148/25, S. 32
Gewerbesteuer
- Mittelbarer Gesellschafter als Gesellschafter i. S. des § 9 Nr. 1 Satz 5 GewStG, FG Köln, Urteil vom 26.02.2025, 3 K 2322/21, S. 36
Grunderwerbsteuer
- Einheitliches Vertragswerk in der GrESt, FG München, Urteil vom 25.06.2025, 4 K 1198/22, S. 42
Steuerberatungsrecht
- Widerruf einer Steuerberaterbestellung wegen unvereinbarer Angestelltentätigkeit bei einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft, FG Münster, Urteil vom 29.08.2025, 4 K 258/25, S. 47
Umsatzsteuer
- Aufgliederung der Arrestsumme nach Voranmeldungszeiträumen; Zurechnung von Prostitutionsumsätzen trotz ausdrücklicher Verwahrung, FG Nürnberg, Urteil vom 29.04.2025, 2 K 727/18, S. 52
Umwandlung
- Kein Drittanfechtungsrecht des Einbringenden und folglich auch keine notwendige Einzelbekanntgabe an diesen in Fällen des § 24 UmwStG, FG Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Urteil vom 01.10.2024, 11 K 2174/22, S. 65
Inhalt EFG 24/2025
Abgabenordnung
- Keine eidesstattliche Versicherung von datenschutzrechtlichen Auskünften, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.02.2025, 16 K 16076/23, S. 1721
Abgabenordnung/Einkommensteuer
- Keine Rückwirkung des neuen Forschungszulagengesetzes, FG Baden-Württemberg, Urteil vom 14.03.2025, 5 K 2302/24, S. 1724
Bewertungsrecht/Finanzgerichtsordnung
- Streitwert bei Anfechtung eines Grundsteuermessbetrags (neues Recht, Bundesmodell), FG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 07.10.2025, 3 K 3039/25, S. 1726
Einkommensteuer
- Fahrtkosten eines LKW-Fahrers zum Betriebssitz sind Reisekosten, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 25.02.2025, 15 K 3114/23, S. 1728
- Keine betriebliche Berücksichtigung von Verlusten aus Warentermingeschäften, wenn diese objektiv nicht geeignet sind, ein Betriebsrisiko abzusichern, FG München, Urteil vom 28.08.2025, 10 K 332/23, S. 1732
- Zur bilanziellen Behandlung einer Umsatzsteuer-Erstattung in den sog. Bauträger-Fällen, Niedersächsisches FG, Urteil vom 15.10.2025, 13 K 134/24, S. 1735
- Personelle Reichweite des Generationennachfolge-Verbunds, FG Baden-Württemberg, Urteil vom 21.10.2024, 9 K 2098/22, S. 1740
- Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen, Niedersächsisches FG, Urteil vom 10.06.2025, 13 K 157/24, S. 1745
Einkommensteuer/Körperschaftsteuer
- Zinsschranke: Feststellung eines EBITDA-Vortrags in Fällen eines positiven Zinsüberhangs nach § 4h Abs. 1 Satz 3 EStG a. F., FG Köln, Urteil vom 26.06.2025, 13 K 1975/22, S. 1753
Einkommensteuer/Umsatzsteuer
- Masseverbindlichkeiten bei Schwarzeinnahmen, FG Köln, Urteil vom 08.06.2022, 4 K 2134/20, S. 1759
Gewerbesteuer
- Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Aufwendungen für die Nutzung von Außenflächen auf Verkehrsmitteln zu Werbezwecken, FG Baden-Württemberg, Urteil vom 10.09.2024, 6 K 1753/20, S. 1762
Grunderwerbsteuer
- Keine mittelbare Beteiligung am Kapital oder Gesellschaftsvermögen i. S. des § 6a Satz 4 GrEStG infolge einer allein wirtschaftlichen Zurechnung von Anteilen auf Grund eines Treuhandverhältnisses, FG Nürnberg, Urteil vom 03.04.2025, 4 K 1295/23, S. 1768
Grundsteuer
- Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer B nach dem Bayerischen Grundsteuergesetz (BayGrStG), FG München, Urteil vom 13.08.2025, 4 K 164/25, S. 1772
Körperschaftsteuer
- Eine vGA begründet keine partielle Gewerbesteuerpflicht, Niedersächsisches FG, Urteil vom 27.02.2025, 10 K 37/24, S. 1778
- Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags bei nachträglicher Verschiebung des Beginns der Laufzeit, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 08.07.2025, 8 K 8092/24, S. 1782
Schenkungsteuer
- Freigebige Zuwendung i. S. des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG an den anderen Ehegatten bei Verschaffung einer Gesamtgläubigerstellung bzgl. eines Wohnrechts und eines Geldzahlungsanspruchs im Zuge einer Vermögensübertragung an die nächste Generation, FG Münster, Urteil vom 18.09.2025, 3 K 459/24 Erb, S. 1788
Umsatzsteuer
- Keine Verschaffung der Verfügungsmacht i. S. des § 3 Abs. 1 UStG an den Finetrader im Rahmen von sog. Finetrading-Geschäften, FG Münster, Beschluss vom 26.08.2025, 5 V 609/25 U, S. 1790
Umsatzsteuer/Abgabenordnung
- Korrektur der Umsatzsteuerfestsetzung in sog. Bauträgerfällen – hier: zutreffende Bemessungsgrundlage bei irrtümlicher Annahme von § 13b UStG, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18.06.2025, 7 K 7039/22, S. 1796
Inhalt EFG 23/2025
Abgabenordnung
- Steuererklärungspflicht als Voraussetzung eines Verspätungszuschlags, Niedersächsisches FG, Urteil vom 25.03.2024, 4 K 1/24, S. 1649
- Änderungsbefugnis nach § 175b Abs. 1 AO im Falle der Korrektur der ursprünglich übermittelten und bei der Steuerfestsetzung berücksichtigten Daten, Niedersächsisches FG, Urteil vom 07.11.2024, 2 K 78/24, S. 1652
Abgabenordnung/Körperschaftsteuer
- Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten bei Wertpapierdarlehensgeschäften, Niedersächsisches FG, Urteil vom 24.04.2025, 6 K 86/22, S. 1656
Abgabenordnung/Umsatzsteuer
- Änderung einer Zinsfestsetzung; Anrechnung von Erstattungszinsen auf Prozesszinsen; Hinzurechnung bisher festzusetzender Zinsen; Zahlungsverjährung, FG des Saarlandes, Urteil vom 20.08.2025, 1 K 1118/22, S. 1667
Abgabenordnung/Umwandlung
- § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG verstößt gegen Fusionsrichtlinie, Hessisches FG, Urteil vom 22.05.2025, 3 K 778/21, S. 1669
Bewertungsrecht
- Bedarfsbewertung: Überprüfung von Liegenschaftszinssätzen, FG München, Urteil vom 02.04.2025, 4 K 978/22, S. 1676
Einkommensteuer
- Keine Teilgewinnrealisierung im Rahmen eines schwebenden Geschäfts durch bloße Kaufpreisteilzahlungen, FG Düsseldorf, Urteil vom 24.09.2025, 10 K 459/23 G, F, S. 1682
- Kein scheidungsbedingter Übergang des Wohnförderkontos bei vorheriger Aufgabe der Selbstnutzung im Trennungsjahr, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 28.01.2025, 15 K 15079/24, S. 1685
Einkommensteuer/Doppelbesteuerungsabkommen
- Grenzgänger – Berechnung der schädlichen Tage bei Dienstreisen, FG des Saarlandes, Urteil vom 10.04.2025, 2 K 1149/21, S. 1689
Einkommensteuer/Finanzgerichtsordnung
- AdV bei unzureichender Aktenvorlage durch das FA, FG Münster, Beschluss vom 29.09.2025, 1 V 1595/25 E, S. 1692
Einkommensteuer/Körperschaftsteuer
- Abgeltende oder tarifliche Besteuerung einer vGA in Gestalt einer verhinderten Vermögensmehrung durch die unentgeltliche Überlassung einer ausländischen Ferienimmobilie seitens einer KapG an ihre Gesellschafter, FG Düsseldorf, Urteil vom 05.09.2025, 10 K 2605/20 E, S. 1695
Grundsteuer
- Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer B nach dem Bayerischen Grundsteuergesetz (BayGrStG), FG München, Urteil vom 25.06.2025, 4 K 2077/24, S. 1703
Kostengesetze
- Streitwertbemessung bei eventueller Klagehäufung: Berücksichtigung des nicht denselben Gegenstand betreffenden Hilfsantrags nach übereinstimmenden Erledigungserklärungen, Hessisches FG, Beschluss vom 15.09.2025, 11 K 715/25, S. 1706
Umsatzsteuer
- Keine Steuerfreiheit von Schuldner- und Insolvenzberatung, wenn die Leistung als Subunternehmer erbracht wird, Hessisches FG, Urteil vom 29.01.2025, 1 K 13/22, S. 1711