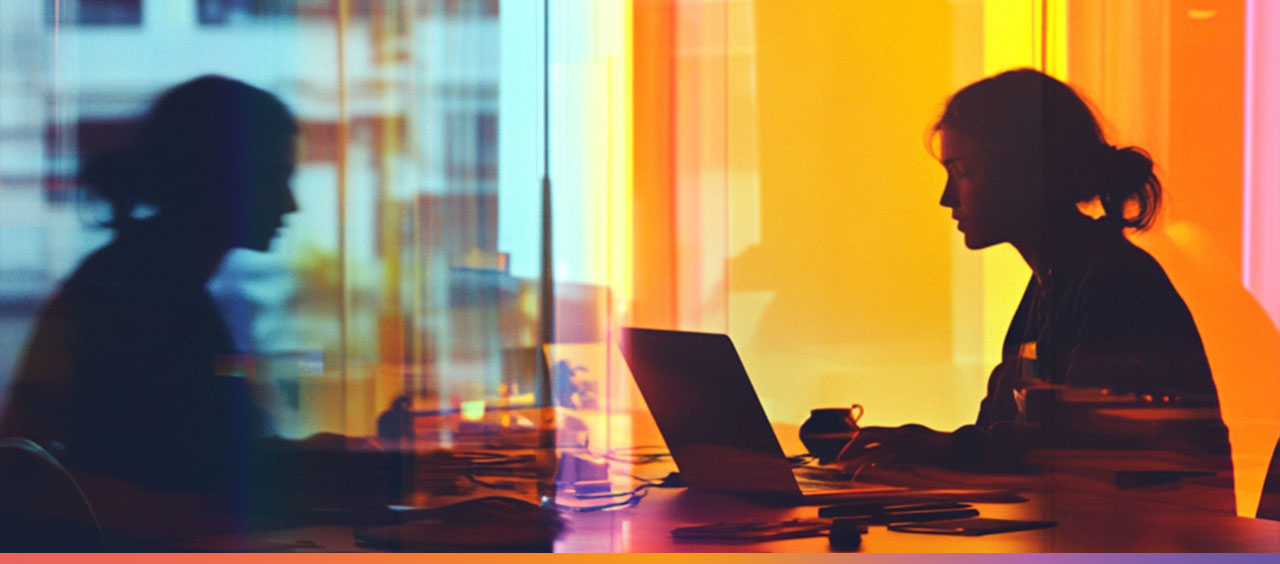BGH zur Formwirksamkeit der Einreichung eines nicht-qualifiziert elektronisch signierten Schriftsatzes über das beA einer prozessbevollmächtigten anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaft
Verfahrens-/Prozessrecht
BGH, Beschluss vom 16.09.2025, VIII ZB 25/25
Verfahrensgang: AG Frankfurt/Main, 33057 C 66/23 vom 10.10.2024
LG Frankfurt/Main, 2-11 S 166/24 vom 20.03.2025
Leitsatz:
Zur Formwirksamkeit der Einreichung eines nicht-qualifiziert elektronisch signierten Schriftsatzes über das besondere elektronische Anwaltspostfach einer prozessbevollmächtigten anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaft.
Gründe:
I. Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Räumung und Herausgabe einer Mietwohnung nebst Stellplatz.
Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen hat die Klägerin durch eine von ihr zur Prozessbevollmächtigten bestellte Rechtsanwaltsgesellschaft, eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, frist- und formgerecht Berufung eingelegt. Innerhalb der Berufungsbegründungsfrist ging bei dem Berufungsgericht eine über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) der prozessbevollmächtigten Rechtsanwaltsgesellschaft (im Folgenden: Gesellschaftspostfach) übermittelte Berufungsbegründung ein. Diese schloss mit dem Namenszug eines Rechtsanwalts, der vertretungsberechtigter Partner der prozessbevollmächtigten Rechtsanwaltsgesellschaft ist.
In dem Prüfvermerk betreffend die Nachricht, mit der die Berufungsbegründung übermittelt wurde, wird bestätigt, dass die Nachricht auf einem sicheren Übermittlungsweg aus einem besonderen elektronischen Postfach übermittelt wurde. Als Absender ist die Rechtsanwaltsgesellschaft benannt. Zudem wurde ein vertrauenswürdiger Herkunftsnachweis (im Folgenden auch: VHN) erstellt. Aus allgemeinen technischen Gründen ist weder aus dem Prüfvermerk noch aus dem VHN ersichtlich, welche natürliche Person die Übermittlung mittels des Gesellschaftspostfachs vorgenommen hat.
Nach einem Hinweis des Berufungsgerichts auf Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Berufung im Hinblick darauf, dass zwischen dem Absender der Nachricht (Rechtsanwaltsgesellschaft) und der signierenden Person (Rechtsanwalt) keine Identität bestehe, hat die Klägerin mit von dem Berufungsgericht in Bezug genommenem Schriftsatz vom 17. März 2025 vorgetragen, der - für die prozessbevollmächtigte Rechtsanwaltsgesellschaft vertretungsberechtigte - Rechtsanwalt, der die Berufungsbegründung (einfach) signiert habe, habe deren Versand über seine Zugangsberechtigung aus dem Gesellschaftspostfach veranlasst, was sich aus dem beigefügten Nachrichtenjournal ergebe.
Das Landgericht hat die Berufung als unzulässig verworfen. Zur Begründung hat es - soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren von Interesse - im Wesentlichen ausgeführt:
Die Berufung sei unzulässig, da sie nicht formgerecht begründet worden sei. Denn sie sei nicht in elektronischer Form mit qualifizierter Signatur oder mit einfacher Signatur auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht worden. Letzteres scheitere daran, dass laut Prüfvermerk der Absender der Berufungsbegründungsschrift nicht der in dem Schriftsatz genannte Rechtsanwalt, sondern die Rechtsanwaltsgesellschaft sei. Die Identität zwischen der einfach signierenden Person und dem Absender der Nachricht sei jedoch erforderlich. Die einfache Signatur solle - wie die eigene Unterschrift oder die qualifizierte elektronische Signatur - die Identifizierung des Urhebers der schriftlichen Verfahrenshandlung ermöglichen und dessen unbedingten Willen zum Ausdruck bringen, die volle Verantwortung für den Inhalt des Schriftsatzes zu übernehmen und diesen bei Gericht einzureichen. Es müsse deshalb sichergestellt sein, dass die von dem Übermittlungsweg ausgewiesene Person mit der Person identisch sei, welche mit der wiedergegebenen Unterschrift die inhaltliche Verantwortung für das Dokument übernehme. Der sichere Übermittlungsweg gewährleiste die Identität des Absenders nur dann, wenn die verantwortende Person, also der Rechtsanwalt als Inhaber des beA, den Versand selbst vornehme. Da vorliegend die Kanzlei als Absender genannt sei und ein konkreter Rechtsanwalt als Absender nicht ermittelt werden könne, fehle es an dieser Voraussetzung.
Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde der Klägerin.
II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die nach § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 522 Abs. 1 Satz 4 ZPO statthafte und auch den Form- und Fristerfordernissen genügende Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts erfordert (§ 574 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 ZPO). Die angefochtene Entscheidung verletzt - wie die Rechtsbeschwerde zu Recht geltend macht - in entscheidungserheblicher Weise das Verfahrensgrundrecht der Klägerin auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes (Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip). Danach darf einer Partei der Zugang zu einer in der Verfahrensordnung eingeräumten Instanz nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden (st. Rspr.; vgl. BVerfGE 74, 228, 234; BVerfG, NZA 2016, 122 Rn. 10; BGH, Beschlüsse vom 16. Januar 2024 - VI ZB 45/23, NJW-RR 2024, 474 Rn. 6; vom 7. März 2023 - VI ZB 74/22, NJW 2023, 2280 Rn. 6; vom 13. Dezember 2022 - VIII ZB 43/22, WuM 2023, 224 Rn. 9; vom 12. Juli 2016 - VIII ZB 55/15, WuM 2016,632 Rn. 1; jeweils mwN). Nach dieser Maßgabe hat das Berufungsgericht der Klägerin den Zugang zu der Berufungsinstanz unzulässig verwehrt, indem es ihre Berufung mit der Begründung verworfen hat, es fehle an einer ordnungsgemäßen Berufungsbegründung, weil diese nicht von dem Rechtsanwalt über das besondere elektronische Anwaltspostfach versandt worden sei, der sie einfach signiert habe.
Darüber hinaus hat das Berufungsgericht - wie die Rechtsbeschwerde ebenfalls zutreffend geltend macht - den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) dadurch verletzt, dass es deren Vortrag zur Einhaltung der vom Gesetzgeber für eine wirksame Übermittlung mittels eines Gesellschaftspostfachs aufgestellten Voraussetzungen und zu der Einreichung der Berufungsbegründung über das Gesellschaftspostfach der prozessbevollmächtigten anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaft (im Folgenden auch: Berufsausübungsgesellschaft) durch den Rechtsanwalt, der die Berufungsbegründung signiert hat, nicht beachtet und erwogen hat.
2. Die Rechtsbeschwerde hat auch in der Sache Erfolg.
Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann die Berufung nicht als unzulässig verworfen werden. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die Berufungsbegründung der Klägerin in einer den Anforderungen des § 130a Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2 ZPO entsprechenden Weise wirksam als elektronisches Dokument bei dem zuständigen Gericht eingegangen.
Nach § 130a Abs. 3 Satz 1 ZPO muss ein elektronisches Dokument entweder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. Ein sicherer Übermittlungsweg ist nach § 130a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ZPO unter anderem die Übermittlung zwischen den besonderen elektronischen Anwaltspostfächern nach §§ 31a und 31b BRAO und der elektronischen Poststelle des Gerichts.
Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht die Voraussetzungen einer wirksamen Einreichung der Berufungsbegründung der Klägerin nach diesen Vorgaben verneint. Die Berufungsbegründung der Klägerin war im Sinne des § 130a Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2 ZPO von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg - dem Gesellschaftspostfach der prozessbevollmächtigten Berufsausübungsgesellschaft (§ 130a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ZPO in Verbindung mit § 31b BRAO) - eingereicht worden.
a) Eine einfache Signatur der Berufungsbegründung von einem für die prozessbevollmächtigte Berufsausübungsgesellschaft vertretungsberechtigten und postulationsfähigen Rechtsanwalt lag vor. Hierfür genügt es, wenn am Ende des Schriftsatzes der Name des Verfassers maschinenschriftlich wiedergegeben ist (vgl. BGH, Beschlüsse vom 8. Juli 2025 - VIII ZB 12/25, juris Rn. 15; vom 9. April 2025 - XII ZB 599/23, NJW 2025, 2257 Rn. 6; vom 30. November 2023 - III ZB 4/23, NJW-RR 2024, 331 Rn. 10; vom 7. September 2022 - XII ZB 215/22, NJW 2022, 3512 Rn. 10). Dies war hier der Fall.
b) Die Berufungsbegründung wurde auch wirksam über einen sicheren Übermittlungsweg eingereicht.
aa) Im Zuge der Einführung eines Gesellschaftspostfachs für Berufsausübungsgesellschaften durch das Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe vom 7. Juli 2021 (BGBl. I S. 2363) hat der Gesetzgeber durch den in § 130a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ZPO eingefügten Verweis auf die Regelung über das Gesellschaftspostfach (§ 31b BRAO) die Übermittlung über ein solches als sicheren Übermittlungsweg qualifiziert, über den eine formwahrende Einreichung von nicht-qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten grundsätzlich möglich ist. Dies entspricht dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, der die Versendung eines Schriftsatzes über ein Gesellschaftspostfach im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens - anders als noch in dem ursprünglichen Entwurf des vorbezeichneten Gesetzes (vgl. BT-Drucks. 19/27670, S. 157) - als sicheren Übermittlungsweg qualifiziert hat, um zugelassenen Berufsausübungsgesellschaften zu ermöglichen, auf diesem Weg elektronische Dokumente bei Gericht einzureichen, ohne eine qualifizierte elektronische Signatur zu nutzen (vgl. BT-Drucks. 19/30516, S. 50 f., 70). Hierdurch sollte der Regelung in § 59l Abs. 1 Satz 1 BRAO, wonach Berufsausübungsgesellschaften als Prozess- oder Verfahrensbevollmächtigte bestellt werden können, auch für den Bereich des Empfangs und der Übermittlung von elektronischen Dokumenten Rechnung getragen werden (vgl. BT-Drucks. 19/27670, S. 342).
bb) Während bei einem persönlichen besonderen Anwaltspostfach eine wirksame Übermittlung nicht-qualifiziert elektronisch signierter Dokumente auf einem sicheren Übermittlungsweg nur durch den Postfachinhaber selbst ausgeführt werden kann und dieser nach § 23 Abs. 3 Satz 5 der Verordnung über die Rechtsanwaltsverzeichnisse und die besonderen elektronischen Anwaltspostfächer (Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung - RAVPV) das Recht hierzu nicht auf andere Personen übertragen kann, erfolgt bei einem Gesellschaftspostfach notwendigerweise die Versendung durch eine natürliche Person, die mithin nicht Postfachinhaberin ist. Diese Person muss, um eine wirksame Übermittlung eines einfach signierten elektronischen Dokuments über ein Gesellschaftspostfach vornehmen zu können, für die Gesellschaft vertretungsberechtigt und selbst postulationsfähig sein. Denn die Berufsausübungsgesellschaft kann nur durch ihrerseits postulationsfähige vertretungsberechtigte Personen vertreten werden (vgl. § 59l Abs. 2 BRAO). Die Berufsausübungsgesellschaft darf deshalb nach § 23 Abs. 3 Satz 7 RAVPV das Recht, nicht-qualifiziert elektronisch signierte Dokumente für sie auf einem sicheren Übermittlungsweg zu versenden, nur solchen vertretungsberechtigten Rechtsanwälten einräumen, die ihren Beruf in der Berufsausübungsgesellschaft ausüben (sogenannte VHN-Berechtigte).
Um dem Empfänger einer über ein Gesellschaftspostfach versandten Nachricht die Überprüfung der Vertretungsbefugnis und der Postulationsfähigkeit der die Nachricht versendenden natürlichen Person zu ermöglichen, hat die Bundesrechtsanwaltskammer nach § 20 Abs. 3 Nr. 2 RAVPV zu gewährleisten, dass bei der Übermittlung eines Dokuments mit einer nicht-qualifizierten elektronischen Signatur über ein Gesellschaftspostfach für den Empfänger feststellbar ist, dass die Nachricht durch einen Rechtsanwalt versandt wurde, der zur Vertretung der Berufsausübungsgesellschaft berechtigt ist. Dies erfolgt dadurch, dass das System prüft, ob im Zeitpunkt des Nachrichtenversands eine Person an dem Postfach angemeldet ist, die über die VHN-Berechtigung der Berufsausübungsgesellschaft verfügt. Nur in diesem Fall erhält die Nachricht einen vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis (VHN) und wird in dem zugehörigen Prüfvermerk aufgeführt, dass die Nachricht auf einem sicheren Übermittlungsweg aus einem besonderen elektronischen Anwaltspostfach eingereicht wurde (vgl. BT-Drucks. 20/1672, S. 26; Information der BRAK zur Einführung des Gesellschaftspostfach, abrufbar unter https://portal.beasupport.de/fragen-antworten/kategorie/allgemeine-fragen/informationen-zur-einfuehrung-des-gesellschaftspostfachs, Suchnummer 6056; jurisPK-ERV/Müller, Stand: 23. Juni 2025, § 130a ZPO Rn. 197 ff., 231 ff., 274).
cc) Die vorgenannten Voraussetzungen für eine wirksame Einreichung auf dem sicheren Übermittlungsweg des Gesellschaftspostfachs liegen hier hinsichtlich der Berufungsbegründung vor. Diese wurde über das Gesellschaftspostfach der von der Klägerin als Prozessbevollmächtigte bestellten Berufsausübungsgesellschaft eingereicht. Ein vertrauenswürdiger Herkunftsnachweis und damit der Nachweis der Einreichung durch eine hierzu nach § 23 Abs. 3 Satz 7 RAVPV berechtigte Person, liegt vor.
dd) Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht eine wirksame Einreichung der Berufungsbegründungschrift deshalb verneint, weil diese durch den einfach signierenden Rechtsanwalt versandt werden müsse, aus dem Prüfvermerk sowie dem vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis jedoch kein konkreter Rechtsanwalt als Absender ermittelt werden könne.
(1) Der Umstand, dass das Dokument von einem Rechtsanwalt einfach signiert wurde, der sichere Übermittlungsweg ihn jedoch nicht als Absender ausweist, hindert als solcher eine wirksame Übermittlung bei der Versendung über ein Gesellschaftspostfach nicht. Denn dies ist systemimmanent dadurch bedingt, dass Postfachinhaberin des nicht personengebundenen Gesellschaftspostfachs die prozessbevollmächtigte Berufsausübungsgesellschaft ist, die dementsprechend auch als Absenderin der Nachricht ausgewiesen wird. Diese muss sich jedoch notwendigerweise sowohl bei der Signatur als auch bei der Durchführung des Versands durch eine - nicht als Absender der Nachricht erscheinende - natürliche Person vertreten lassen. Würde - was das Berufungsgericht zumindest andeutet - dennoch gefordert, dass der signierende Rechtsanwalt als Absender der Nachricht ausgewiesen wird, wäre eine Einreichung eines nicht-qualifiziert elektronisch signierten Schriftsatzes über ein Gesellschaftspostfach stets unzulässig. Dies widerspräche dem Willen des Gesetzgebers, der diese Möglichkeit ausdrücklich eröffnen wollte.
(2) Vieles spricht, anders als das Berufungsgericht offenbar gemeint hat, dafür, dass im Fall der Bevollmächtigung einer Berufsausübungsgesellschaft und der Nutzung von deren Gesellschaftspostfach eine Identität zwischen dem Rechtsanwalt, der den Schriftsatz für die prozessbevollmächtigte Berufsausübungsgesellschaft einfach signiert, und dem die Versendung vornehmenden Rechtsanwalt nicht erforderlich ist.
Die Frage, ob im Fall der Prozessbevollmächtigung einer Berufsausübungsgesellschaft und der Nutzung von deren Gesellschaftspostfach für die Einreichung eines nicht-qualifiziert elektronisch signierten Dokuments derselbe Rechtsanwalt, der in Vertretung der Gesellschaft das Dokument einfach signiert hat, auch die Versendung unter Anmeldung an dem Gesellschaftspostfach und Nutzung seiner VHN-Berechtigung vornehmen muss, wird unterschiedlich beurteilt und ist bislang höchstrichterlich nicht geklärt (verneinend: FG Köln, DStRE 2025, 304 Rn. 20 [zu § 52a Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FGO]; jurisPK-ERV/Müller, Stand: 23. Juni 2025, § 130a ZPO Rn. 208.2, 217.1, 223 f., 279 f.; Müller, E-Justice Handbuch, 8. Aufl., S. 138 f., 194 f.; bejahend: Jungbauer/Jungbauer, Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) und der ERV, 4. Aufl., § 2 Rn. 36; offen und im Hinblick darauf die Nutzung einer qualifizierten elektronischen Signatur empfehlend: BRAK und DAV, beA-Newsletter 8/2022 vom 29. September 2022, abrufbar unter www.brak.de).
(a) Nach einhelliger höchstrichterlicher Rechtsprechung ist es bei der Einreichung eines nicht-qualifiziert elektronisch signierten Dokuments über ein persönliches elektronisches Anwaltspostfach Wirksamkeitsvoraussetzung, dass der das Dokument einfach signierende verantwortliche Prozessbevollmächtigte die Übermittlung über sein beA selbst vornimmt (vgl. BGH, Beschlüsse vom 8. Juli 2025 - VIII ZB 12/25, juris Rn. 18; vom 3. Juli 2024 - XII ZB 538/23, NJW 2024, 2996 Rn. 9; vom 7. Mai 2024 - VI ZB 22/23, NJW-RR 2024, 1058 Rn. 5 f.; vom 7. September 2022 - XII ZB 215/22, NJW 2022, 3512 Rn. 15; vom 30. März 2022 - XII ZB 311/21, NJW 2022, 2415 Rn. 11; vom 4. Oktober 2023 - 3 StR 292/23, juris Rn. 2 [zu § 32a Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 StPO]; BAG, NJW 2020, 2351 Rn. 13 ff.; BFH, DStR 2025, 100 Rn. 23 f. [zu § 52a Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FGO]; BVerwG, NVwZ 2022, 649 Rn. 4 ff. [zu § 55a Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO]; BSG, NJW 2022, 1334 Rn. 7 [zu § 65a Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SGG]).
(b) Diese Rechtsprechung kann jedoch - was das Berufungsgericht verkannt hat - nicht ohne Weiteres auf die Übermittlung eines nicht-qualifiziert elektronisch signierten Dokuments mittels des Gesellschaftspostfachs einer prozessbevollmächtigten Berufsausübungsgesellschaft übertragen werden. Zum einen handelt es sich bei dem Gesellschaftspostfach - wie bei einem besonderen Behördenpostfach (§ 130a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 ZPO) und anders als bei dem einem Anwalt persönlich zugeordneten elektronischen Anwaltspostfach - um ein nicht personengebundenes besonderes elektronisches Anwaltspostfach. Zum anderen müssen bei der Prozessbevollmächtigung einer Berufsausübungsgesellschaft sowohl die Signatur als auch der Versand notwendigerweise durch vertretungsberechtigte Rechtsanwälte ausgeführt werden (siehe oben II 2 b bb). Auf Grund dieser Unterschiede entsprechen die Anforderungen zur Sicherstellung der Authentizität und Integrität des auf dem sicheren Übermittlungsweg eines Gesellschaftspostfachs eingereichten Dokuments nicht denjenigen für die Einreichung über ein persönliches elektronisches Anwaltspostfach eines prozessbevollmächtigten Rechtsanwalts.
Eine als Prozessbevollmächtigte beauftragte Berufsausübungsgesellschaft hat zwar gemäß § 59l Abs. 1 Satz 2 BRAO die Rechte und Pflichten eines Rechtsanwalts und trägt damit letztlich die Verantwortung für die Erfüllung der anwaltlichen Pflichten, sie muss sich hierbei aber notwendigerweise durch natürliche Personen vertreten lassen, die ihrerseits postulationsfähig sein müssen (§ 59l Abs. 2 BRAO). Diese Rechtslage wird im Rahmen der Bestimmungen über die Berechtigungen zur Nutzung des besonderen Anwaltspostfachs für die Einreichung nicht-qualifiziert elektronisch signierter Dokumente nachvollzogen. Die Berufsausübungsgesellschaft als Postfachinhaberin darf - und muss - zur Ermöglichung einer Einreichung, die nur eine natürliche Person vornehmen kann, dieses Recht auf natürliche Personen übertragen. Die Übertragung darf hierbei nur auf vertretungsberechtigte Rechtsanwälte, die ihren Beruf in der Berufsausübungsgesellschaft ausüben, erfolgen (§ 23 Abs. 3 Satz 7 RAVPV). Die Bundesrechtsanwaltskammer hat zu gewährleisten, dass der Empfänger diese Vorgaben überprüfen kann (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 RAVPV).
(c) Vor diesem Hintergrund ist der sichere Übermittlungsweg mittels eines nicht personengebundenen Gesellschaftspostfachs, bei dem durch die vorstehend genannten Regelungen der Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung die Authentizität mit Blick auf die Herkunft eines übermittelten Dokuments von der prozessbevollmächtigten Gesellschaft gewährleistet werden soll, mit dem ebenfalls nicht personengebundenen Übermittlungsweg mittels eines besonderen Behördenpostfachs und den dort zur Gewährleistung der Authentizität in § 8 der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) getroffenen Regelungen vergleichbar. Hiernach stellt die Behörde als Postfachinhaberin den Zugang bestimmten Zugangsberechtigten zur Verfügung, die über ein Zertifikat und Passwort eine Versendung aus dem Behördenpostfach vornehmen können. Die Versendung durch einen Zugangsberechtigten wird durch den vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis bestätigt (vgl. BGH, Beschluss vom 6. April 2023 - I ZB 84/22, NJW-RR 2023, 906 Rn. 18 f., 28 ff.).
Für eine wirksame Einreichung eines nicht-qualifiziert elektronisch signierten Dokuments über den gemäß § 130a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 ZPO sicheren Übermittlungsweg eines besonderen elektronischen Behördenpostfachs bedarf es nach höchstrichterlicher Rechtsprechung einer Personenidentität zwischen sendender und einfach signierender Person nicht (vgl. BGH, Beschluss vom 6. April 2023 - I ZB 84/22, NJW-RR 2023, 906 Rn. 28 ff.; BAG, NZA 2024, 1735 Rn. 19 ff. [zu § 46c Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 ArbGG]; BVerwG, Beschluss vom 18. Mai 2020 - 1 B 23/20, 1 PKH 14/20, juris Rn. 5 [zu § 55a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 VwGO]; jurisPK-ERV/Müller, Stand: 23. Juni 2025, § 130a ZPO Rn. 223 ff.; Müller, RDi 2022, 92, 95). Vielmehr genügt der über den vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis (VHN) bestätigte Umstand, dass bei der Übersendung ein nach § 8 Abs. 1 bis 4 ERVV mit Zertifikat und Zertifikats-Passwort ausgestatteter zugangsberechtigter Beschäftigter des Postfachinhabers mit den vom Postfachinhaber zur Verfügung gestellten Zugangsdaten bei dem Verzeichnisdienst angemeldet war (vgl. BGH, Beschluss vom 6. April 2023 - I ZB 84/22, aaO Rn. 19, 28 ff.; BAG, aaO Rn. 19). Denn durch die Einreichung über einen sicheren Übermittlungsweg ist die Authentizität des Dokuments mit Blick auf dessen Herkunft von der befugten Behörde gewährleistet und damit der Gefahr begegnet, dass nicht zu der Behörde gehörende Personen ein fingiertes Dokument einreichen (vgl. BGH, Beschluss vom 6. April 2023 - I ZB 84/22, aaO Rn. 28; BAG, aaO Rn. 20).
(d) Vor dem Hintergrund der Vergleichbarkeit der nicht personengebundenen Übermittlungswege mittels eines Gesellschaftspostfachs und eines Behördenpostfachs liegt es nahe, entsprechend der vorgenannten Rechtsprechung auch im Fall der Übermittlung eines nicht-qualifiziert elektronisch signierten Dokuments für eine prozessbevollmächtigte Berufsausübungsgesellschaft über ein Gesellschaftspostfach grundsätzlich - und anders als im Fall einer Einreichung durch einen prozessbevollmächtigten einfach signierenden Rechtsanwalt über dessen persönliches Anwaltspostfach - eine Identität zwischen dem einfach signierenden Rechtsanwalt und dem den Sendevorgang über das Gesellschaftspostfach veranlassenden VHN-berechtigten Rechtsanwalt nicht als erforderlich anzusehen.
(3) Diese Frage bedarf hier indes keiner abschließenden Entscheidung. Denn die Berufungsbegründung wurde - was das Berufungsgericht verkannt hat - nachweislich von demjenigen für die prozessbevollmächtigte Gesellschaft vertretungsberechtigten Rechtsanwalt über das Gesellschaftspostfach versandt, der diesen Schriftsatz auch einfach signiert hat.
Zwar ergibt sich dies nicht bereits aus dem Prüfprotokoll und dem vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis (VHN). Diesen Dokumenten ist jeweils nur zu entnehmen, dass die Übermittlung durch einen VHN-Berechtigten erfolgt ist, während die Identität der die Nachricht versendenden Person - jedenfalls derzeit und so auch hier - aus technischen Gründen hieraus nicht ersichtlich ist (vgl. BRAK und DAV, beA-Newsletter 8/2022 vom 29. September 2022, abrufbar unter www.brak.de). Welcher Rechtsanwalt die Nachricht versandt hat, lässt sich indes über das der betreffenden Nachricht zuzuordnende Nachrichtenjournal nachvollziehen, das erkennen lässt, welcher Nutzer zum Zeitpunkt des Versands an dem Gesellschaftspostfach angemeldet war und unter welchem Benutzernamen der Versand erfolgte (vgl. BRAK und DAV, beA-Newsletter 8/2022 vom 29. September 2022; aaO). Dies ist - was das Berufungsgericht außer Betracht gelassen hat - zum Nachweis der Personenidentität ausreichend.
Die Unwirksamkeit der Einreichung des elektronischen Schriftsatzes kann dagegen nicht damit begründet werden, dass das Gericht die Identität des Versenders nicht über das ihm selbst unmittelbar zugängliche Prüfprotokoll und den zugehörigen vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis feststellen kann. Auch wenn der Gesetzgeber ausweislich der Begründung des Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 15. Juli 2022 (BGBl. I S. 1146), mit dem die letztlich in Kraft getretenen Fassungen der Regelungen zum Gesellschaftspostfach eingeführt wurden, davon ausging, dass die Identität des versendenden VHN-Berechtigten zumindest über die Visitenkarte unter der Nutzer-ID angegeben werden sollte (BT-Drucks. 20/1672, S. 26), ist diese Angabe für die Wirksamkeit der Übermittlung nicht maßgeblich, sondern dient allein der erleichterten Feststellbarkeit des für die Wirksamkeit der Ermittlung erforderlichen Umstands, dass die Berufsausübungsgesellschaft durch einen vertretungsberechtigten Rechtsanwalt vertreten wurde (vgl. BT-Drucks. 20/1672, aaO).
Es würde den Zugang einer prozessbevollmächtigten Berufsausübungsgesellschaft - hier - zu der Berufungsinstanz in aus Sachgründen nicht zu rechtfertigender Weise unzumutbar einschränken, wenn ihr die fehlende Angabe der Identität des versendenden Rechtsanwalts in dem Prüfprotokoll und dem vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis entgegengehalten werden dürfte und ihr der anderweitige Nachweis durch das Nachrichtenjournal versagt würde, obwohl die fehlende Erkennbarkeit der Identität der versendenden Person auf technischen Problemen beruht, die nicht im Einflussbereich der das Gesellschaftspostfach zulässigerweise als sicheren Übermittlungsweg nutzenden prozessbevollmächtigten Berufsausübungsgesellschaft liegen (vgl. Jungbauer/Jungbauer, Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) und der ERV, 4. Aufl., § 2 Rn. 36).
Dementsprechend ist - was das Berufungsgericht nicht hinreichend in den Blick genommen hat - durch das von der Klägerin vorgelegte Nachrichtenjournal nachgewiesen, dass hier derselbe Rechtsanwalt die Berufungsbegründung sowohl signiert als auch über das Gesellschaftspostfach an das Gericht gesandt hat.
3. Nach alledem kann die angefochtene Entscheidung keinen Bestand haben. Sie ist aufzuheben und die Sache ist an das Berufungsgericht zur erneuten Entscheidung über die Berufung zurückzuverweisen (§ 577 Abs. 4 Satz 1 ZPO).